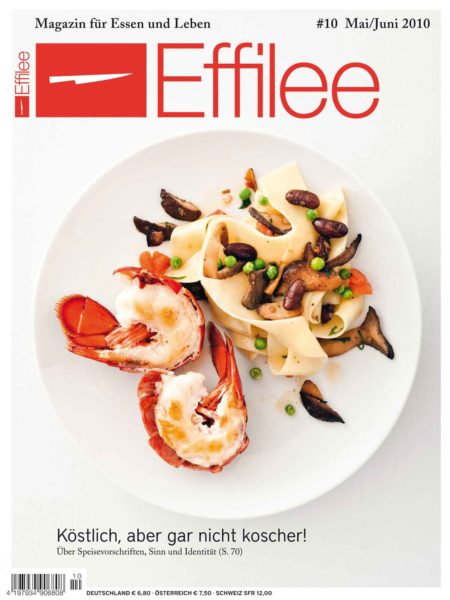Der Prinz, ein Cousin Ludwig des Fünfzehnten, wollte mit dieser Investition vor allem seinen eigenen Bedarf auf möglichst hohem Niveau sichern. Nun war immer schon die Qualität eines Weines direkt an den Aufwand gekoppelt, den der Winzer damit treibt: wie sorgfältig die Reben beschnitten und gepflegt werden, wie kleinlich man beim Aussortieren der Trauben vorgeht, ob die Stiele mitgepresst werden oder nicht. Conti musste sich auf keinerlei Kompromisse einlassen, und sein Wein wurde zum Maß aller Dinge, jedenfalls im Burgund.
Die beiden großen französischen Weinbaugebiete haben sich etwa zeitgleich aber weitgehend unabhängig voneinander entwickelt. Von Bordeaux aus wurde Wein nach England verschifft, das Geschehen dort wurde von englischen und niederländischen Handelshäusern geprägt. Die Weine aus dem Burgund hingegen gingen nach Paris. Die kulturelle Kluft war damals schon gewaltig: dort die weltläufigen protestantischen Händler und hier die katholischen Bauern. Das hat sicher viel dazu beigetragen, dass die Burgunder bei aller Raffinesse immer auch eine gewisse Einfachheit bewahren.
Ob das nun höher zu bewerten ist als die Komplexität der Bordeauxweine - diese Frage entzweit die Kenner bis heute. Man kennt das von so Fragen wie jener, wer denn der größere Komponist sei, Mozart oder Wagner. Wir trinken die Flasche zu viert: zwei Sommeliers, ein Weinhändler und ich, alle leidenschaftliche Burgundertrinker. Einer der Sommeliers öffnet die Flasche und riecht vorsichtig. „Ich glaube, wir haben Glück!“, sagt er und grinst. Kein Kork, kein anderer Fehler. Da dieser Wein sicher ausgereift und nicht mehr auf viel Luft angewiesen ist, nehmen wir nicht die riesigen „Goldfischgläser“, sondern die einfachen Burgundergläser.
Der Wein ist eher ziegel- als rubinrot, der erste Schluck kommt fast ein wenig zart rüber. Aber dann fängt der Wein an, seine Geschichte zu erzählen, schlank, aber energisch und abgeklärt. Und wie alle guten Geschichten so, dass man sie nicht wirklich adäquat nacherzählen könnte. Wir füllen immer nur kleine Pfützen in die Gläser und trinken in ganz, ganz kleinen Schlucken.
Zwischendurch immer lange riechen, schwenken, riechen, Augen zu, Augen auf. Alle hängen ihren Gedanken nach: 1966, ich kann mich noch - wenn auch dunkel - daran erinnern: Ich war vier. Im Garten stand ein ausgedienter 2CV, in dem wir spielen durften, und eine Schaukel, an die man sich mit dem Kopf nach unten hängen konnte. Das nannte sich Schweinebummeln. Und meine Cousine und ich fanden heraus, dass wir an entscheidenden Stellen unterschiedlich aussahen. Keiner spricht. Über der Elbe geht die Sonne unter. Ganz am Schluss sagt doch einer was: „Das war eine glückliche Flasche!“ Wir anderen nicken. Was soll man dem hinzufügen?
Meine Meinung …