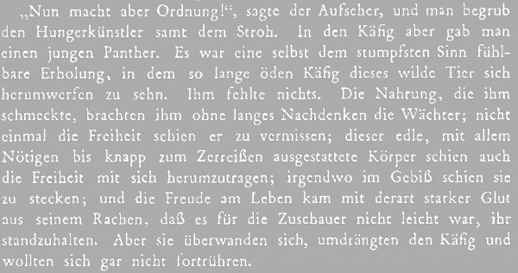
1. MAN KANN NICHT ZU DÜNN SEIN
Rote Buchstaben auf einer grauen Tafel: Thou shall not eat without feeling guilty. Das nächste Bild, grüne Buchstaben auf einer weißen Tafel: Losing weight is good. Gaining weight is bad. Rot auf weiß: You can never be too thin. Daneben sieben weitere Tafeln mit ähnlichen Sätzen.
Die Bildreihe The Thin Commandments von Johannes Wohnseifer ist so reduziert und dabei auf eine elegante Weise so kalt und nackt, dass der Betrachter vieles hineininterpretieren kann - so mancher wird sich deshalb wohl an dem erklärenden Text festklammern. Andere werden The Thin Commandments aus rein ästhetischen Gründen bewundern. Mich fasziniert dieses Kunstwerk vor allem, weil ich mich in ihm wiedererkenne.
Genauer gesagt erkenne ich eine Welt, in der ich mich als magersüchtige Jugendliche ein Jahr befand. Die Thin Commandments dokumentieren die Leitlinien eines Paralleluniversums, in dem es ausschließlich darum geht, nicht zu essen, Gewicht zu verlieren und immer dünner zu werden. Die abstrakten Bilder zeigen eine kranke, aber attraktiv simplifi zierte Welt. Eine Welt, der immer mehr Menschen verfallen und der Ärzte, Therapeuten, Eltern oder Freunde oft ratlos gegenüber stehen. Doch warum ist das so? Warum hören junge, scheinbar gesunde Menschen auf zu essen? Und warum kann man sie nur schwer dazu bringen, wieder damit anzufangen?

2. GUTE LAUNE OHNE ESSEN
Eigentlich geht es gar nicht ums Essen! Uneigentlich aber doch … Ich werde versuchen, dieses Dilemma, dem letztlich ein Ringen um Identität zugrunde liegt, zu erklären - zumindest aus meiner Erfahrung. Es kam plötzlich, mit 16 oder 17 vielleicht. Es blieb ein Jahr, verschwand sehr langsam und ich schämte mich noch lange für diesen peinlichen Ausrutscher in meinem Lebenslauf. Erst heute sehe ich die Phase der Magersucht nicht mehr als Krankheit sondern als einen notwendigen Prozess. Aber dazu später mehr.
Warum genau habe ich aufgehört zu essen? Lange Zeit konnte ich das nicht sagen. Zu Hause war alles in Ordnung. Die Familie funktionierte. Meine Schwester und ich waren schon mit zwölf Back- und Kochprofis, wir wälzten Rezeptbücher wie andere Mädchenmagazine. Wir zelebrierten unsere Mahlzeiten, veranstalteten Kaffeekränzchen mit Torte und Kakao und begingen unsere Abendessen wie heilige Messen.
Manchmal bildeten wir uns ein, wir seien zu dick. Dann versuchten wir uns an Diäten oder Trainingsprogrammen, scheiterten aber umgehend. Meine Magersucht knallte in diese heile Welt wie eine Bombe. Aus heiterem Himmel begann ich, auf warme Mittagessen zu verzichten. Ich verlor Gewicht, und das fühlte sich toll an. Ich dachte: »Super, ich werde in Zukunft attraktiv und selbstbewusst durch die Welt gehen …«
In den folgenden Wochen reduzierte ich die Mahlzeiten immer weiter, es war ein schleichender Prozess. Ich verzichtete auf fette Nahrungsmittel und aß keine Süßigkeiten. Ich trank literweise Wasser, bewegte mich extrem viel und stellte mich mehrmals am Tag auf die Waage. Bald ging es mir nur noch um eines: Nicht essen. Ich dachte von morgens bis abends darüber nach, wie ich die nächste Mahlzeit umgehen könnte. Ich zog mich zurück, rannte den ganzen Tag herum und beobachtete meinen Körper beim Dünnerwerden.
Anfangs fühlte ich mich extrem gut. Heute weiß ich, dass das ein Trick der Natur ist: Damit man weiter funktioniert, springt in den ersten Hungerwochen ein körpereigenes Notstromaggregat an, das Gehirn produziert gute Laune in Form von Serotonin und anderen Glückshormonen. Gleichzeitig weiß der Körper, dass er Energie sparen muss, weil nicht genug reinkommt, also werden Blutdruck und Hormonproduktion heruntergefahren. Der Blutkreislauf verlangsamt sich, die Körpertemperatur sinkt … Aufgrund des verlangsamten Stoffwechsels bleiben die vermeintlichen Glücksbringer besonders lange im Blut, sodass man sich über Wochen stark und energiegeladen fühlt, obwohl man nicht genug Energie zu sich nimmt.
Irgendwann war es dann aber vorbei mit dem Glück, es ging bergab. Ich fühlte mich nur müde und von meinen eigenen Essregeln getrieben. Doch ich konnte nicht mehr zurück. Hätte ich begonnen, normal zu essen, hätte das meinen gerade geschaffenen Lebensinhalt zerstört, der alleine darin bestand, immer weiter abzunehmen. Ich freute mich also weiterhin über jedes Gramm, das verschwand. Jeder Knochen, der hervorstach, jede Hose, die schlabberte, gaben mir Selbstbewusstsein.
Und dennoch war ich unzufrieden: Selbst als ich bei 1,68 Meter 44 Kilo wog, fand ich mein Spiegelbild noch zu fett.
Meine Eltern, Geschwister und Freunde sahen das objektiver. Meine Mutter fragte mich, ob ich es schön fände, wie ich aussähe. Und ob ich mir über meine Gesundheit denn keine Sorgen machen würde. Immerhin zöge anhaltendes Untergewicht massive körperliche Schäden nach sich. Sie wollte wissen, warum ich nicht mal wieder etwas Richtiges essen könnte, zum Beispiel ein von ihr liebevoll zubereitetes Mittagessen. Sie war zugleich besorgt, überfordert und gekränkt. Ich zuckte mit den Schultern und dachte: »Was wollt ihr alle? Ich kann machen, was ich will. Außerdem sehe ich ganz normal aus.«
3. DIAGNOSE MAGERSUCHT
Die verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers ist der psychologische Kern der Magersucht, sagt Dr. med. Ernst Pfeiffer, der mir an einem kalten Sonntag im Februar das Phänomen Magersucht aus wissenschaftlicher Sicht erläutert. Der 61-Jährige ist Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Virchow-Klinikum der Charité in Berlin.
Pfeiffer beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den unterschiedlichen Arten von Essstörungen, mit Anorexia nervosa (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht), dem sogenannten Binge-Eating-Syndrom (Essanfälle) und deren Untergruppen. Pfeiffer hat diesen Behandlungsschwerpunkt in der Charité mit aufgebaut.
Wir sitzen in seinem aufgeräumten Büro im 4. Stock, das Notfallhandy im Blick. Man muss da weit ausholen, sagt Pfeiffer gleich zu Anfang. Anorexia nervosa sei nicht rein psychologisch erklärbar. Vor 20 Jahren dachte man, sie sei eine jugendliche Spinnerei, der man mit ein wenig Psychotherapie und ein paar Familiensitzungen entgegenwirken könne. Pfeiffer winkt ab. »Heute wissen wir: Nur reden bringt nichts. Im Gegenteil, wer ausschließlich auf Psychotherapie vertraut, handelt unverantwortlich. Magersucht ist eine schwere psychosomatische Störung. Wir sehen uns mit einem komplexen Ursachenbündel und Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche konfrontiert.«
Magersucht ist ein relativ neues Phänomen. 1845 schrieb der Psychiater Heinrich Hoffmann die Geschichte des Suppenkaspers, eine gruselige Warnung für die Kinder des Bürgertums - angeblich beruht sie auf einer Episode aus Hoffmanns Berufsalltag in der Anstalt für Irre und Epileptische in Frankfurt.
In den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Ärzte aus Frankreich, England und den USA die ersten wissenschaftlichen Aufsätze über eine Krankheit namens Anorexia hysterica, hysterische Appetitlosigkeit, die sie vor allem bei Frauen beobachtet hatten. Zur Behandlung empfahl 1868 William Gull, der mehr als hundert Jahre später verdächtigt wurde, Jack The Rippergewesen zu sein, die Patientinnen von einer willensstarken Person füttern zu lassen.
Seit den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts werden Essstörungen zu einem immer größeren Problem. Laut einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sollen in Deutschland 21,9 Prozent der elf bis siebzehnjährigen Jugendlichen Merkmale einer Essstörung aufweisen.
Essstörungen sind die dritthäufigste psychische Störung unter jungen Mädchen, Magersucht betrifft jede hundertste Frau zwischen zwölf und 20. Und fünf Prozent aller Magersucht-Patienten sterben. Womit Anorexia nervosa die psychische Krankheit mit der höchsten Mortalitätsrate ist.
Warum aber ist es so schwierig, das Syndrom Magersucht zu behandeln, wenn man all das genau weiß? Und warum ist die Chance auf Heilung so schlecht? Nur ein Drittel der Patienten werden zu hundert Prozent gesund! Pfeiffer nickt: »Das ist leider richtig. Essstörungen sind schwer zu fassen, weil sie Körper und Psyche betreffen. Zudem kann man sie nicht als isolierte Krankheiten betrachten. Im Gegenteil, bei vielen Patienten gehen unterschiedliche Essstörungstypen ineinander über. Hinzu kommen meist noch andere psychische Probleme, viele Magersüchtige leiden beispielsweise an Depressionen. Außerdem kommen viele Patienten erst in einem fortgeschrittenen Stadium zu uns, was die Heilung ebenfalls erschwert. Sie haben sich schon sehr weit von einem gesunden Essverhalten und einem realistischen Körperbild entfernt.«
Draußen verzieht sich der Nebel. Patienten spazieren die Kastanienallee des Virchow-Klinikums auf und ab, wie vor hundert Jahren. Die Ursachenforschung sei noch lange nicht abgeschlossen, sagt Pfeiffer »Wir gehen davon aus, dass ein komplexes Ursachenbündel, kombiniert mit einer relativ großen genetischen Bereitschaft, Magersucht bedingt.«
Grundsätzlich lassen sich Magersüchtige in zwei Gruppen teilen: Der aktive Typ ist eher extrovertiert und aggressiv, er neigt zu destruktivem
Verhalten. Menschen, die am restriktiven Typ der Krankheit leiden, weisen ebenfalls bestimmte Persönlichkeitsmerkmale auf: mangelnde soziale Kompetenz, überangepasstes Verhalten, Gefügigkeit, Strebsamkeit, und großen Ehrgeiz. Sie sind schüchtern, übersensibel, hyperaktiv und neigen zu einer pessimistischen Weltsicht.
»Damit jemand mit diesen Merkmalen wirklich erkrankt«, sagt Pfeiffer, »muss er aber zusätzlich eine genetische Bereitschaft für eine psychische Krankheit im Allgemeinen und Magersucht im Besonderen mitbringen. Es gibt keine endgültigen Befunde, aber man geht heute von einer multigenetischen Vererbung aus.«
4. DER GOLDENE KÄFIG
Glaubt man dem Fachmann, sorgten also Ursachenbündel und genetische Bereitschaft auch bei mir dafür, dass ein Diät-Tick zu einem psychosomatischen Syndrom wurde. Die Wesensmerkmale, die Pfeiffer beschreibt, kenne ich: Vor der Krankheit war ich unsicher, überempfindlich und unzufrieden. Ich fühlte mich zu dick, hässlich und wusste nicht, wie ich mich ausdrücken sollte. Ich fühlte mich unverstanden.

Die Welt fand ich unübersichtlich, angsteinflößend und grausam, mich selbst machtlos. Dass ich mir in der zehnten Klasse die Haare blau färbte und fortan mit gesenktem Kopf, schlabbrigen Klamotten und angeekeltem Blick durch die Gegend huschte, war wahrscheinlich mein erster Versuch, diese Machtlosigkeit zu kompensieren.
Die Essstörung war mein zweiter. Doch warum gerade Essen? Könnte man nicht einfach aufhören, sich die Haare zu kämmen oder die Schuhe zuzubinden? Nein, denn all das interessiert niemanden, es bringt die anderen höchstens zum Lachen. Mit dem Essen aufzuhören, ist dagegen radikal destruktiv. Verweigert man die Nahrung, verabschiedet man sich von vielem, was Menschen verbindet: Man trennt sich vom Essen als soziales, herzliches, lustvolles und befriedigendes Ereignis. Man wendet sich ab vom Familienleben, von Freunden und von jeder Lebensfreude. Man zieht sich in ein irreales Paralleluniversum zurück. Alle anderen, denkt man, leben in einer seltsam gefräßigen, gefühlskalten und völlig dekadenten Welt, mit der man nichts zu tun haben möchte.
Es ist ein Gefühl, wie es Franz Kafka in der Geschichte Der Hungerkünstler beschreibt: Da sitzt ein Mann freiwillig in einem Käfig, dessen Kunst das Hungern ist, das Nicht-Teilnehmen an der Welt der anderen. Seine Ersatznahrung ist paradoxerweise die Aufmerksamkeit der Zuschauer - der Hungerkünstler stirbt, als seine Darbietung aus der Mode gerät und ihn niemand mehr sehen will. In seinen letzten Worten bekennt er, dass er nicht freiwillig gehungert hat, sondern nur, weil er keine Speise entdeckt hat, die ihm geschmeckt hat - man könnte sagen, dass er seinen Platz in der Welt nie gefunden hat.
So ist das in der Magersucht: Man entzieht sich allem, buhlt aber gleichzeitig um Aufmerksamkeit. Man macht zwanghaft auf sich aufmerksam, zeigt aber zugleich permanent, wie verachtenswert die anderen sind. Man verstrickt sich in einer hilflosen Selbstinszenierung und sorgt so dafür, dass einen die Mitmenschen als Kranken wahrnehmen. Dabei wünscht man sich in seinem tiefsten Inneren nichts mehr, als dazuzugehören. Fatal ist nur, dass der Wunsch nicht erfüllt werden kann, weil man keine Nähe und keine Hilfe zulässt.
Wie schon gesagt: Spaß machte mir dieser Zustand nur zu Beginn der Krankheit. Nachdem das erste Hochgefühl verflogen war, fühlte ich mich wie der Hungerkünstler im Käfig. Ich hockte in einem Gefängnis, in das ich mich selbst gebracht hatte und dem ich nicht entfliehen konnte. Die Menschen um mich herum waren stets bedrückt und belastet. Ich wünschte mir den Zustand vor der Krankheit zurück. Andererseits weigerte ich mich, Hilfe anzunehmen. In Beratungsstellen und beim Psychiater schwieg ich. Vielleicht hatte ich Angst, dass mein Leben seinen Sinn verlöre, wenn ich mit dem Hungern aufhörte.
Auf jeden Fall war ich mir sicher, dass mir niemand helfen könnte: Warum sollen fremde Menschen etwas über mich wissen, dass ich nicht mal selber weiß? Wie sollen andere Menschen Probleme lösen, für die allein ich verantwortlich bin?
5. NUR REDEN BRINGT NICHTS
»Teilmotiviert« nennt Ernst Pfeiffer das, ohne eine Miene zu verziehen.»Schwierig!« Die meisten Patienten müsse man davon überzeugen, dass sie dringend Hilfe bräuchten. Das sei eine Herausforderung, denn je schlechter der körperliche Zustand, desto weniger realistisch ist das Bild vom eigenen Körper und desto größer die Motivation, weiter zu hungern. Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen.
Deshalb geht es im Virchow-Klinikum zu Therapiebeginn um Ernährungsmanagement, darum also, das Gewicht zu erhöhen und das Essverhalten zu normalisieren. In einem Therapievertrag wird ein Zielgewicht festgelegt, das der Patient im Laufe der Behandlung erreichen muss. »Die Patienten müssen das Essen neu lernen«, sagt Pfeiffer. »Die meisten spüren nicht mehr, was ihr Körper eigentlich braucht. Deshalb erstellen wir Ernährungspläne für sie und zeigen ihnen Fotos, auf denen normale Portionen zu sehen sind.«
Je besser sich jemand an die Gewichtsvereinbarung hält, desto mehr Freiräume und Belohnungen bekommt er. Erst wenn der Patient körperlich stabil ist, geht es daran, die psychosozialen Konflikte aufzuarbeiten, die der Krankheit zugrunde liegen könnten, und sich mit dem Körperbild auseinanderzusetzen. Dazu setzt man in Berlin auch auf Psychotherapie, größere Chancen sieht aber man in der Verhaltens- und Körpertherapie: Bewegung und Tanz sollen den Patienten helfen, ihr Äußeres besser einzuschätzen und zu akzeptieren. Ein selbst entwickeltes Therapiekonzept namens Dialektisch- Behaviorale-Therapie (DBT) soll ihnen zeigen, dass alles eine positive Seite hat (dialektisch) und dass man zwanghaftes Verhalten durch sogenannte Skills ersetzen kann (behavioral).
Doch wie bringt man Essgestörte dazu, den großen Schritt zu tun: zu essen? Ich selber wäre ausgerastet, hätte man mich in der Hochphase meiner Magersucht zum Essen genötigt. Ich hätte mit versteinerter Miene dagesessen, mir vielleicht den einen oder anderen Bissen hineingezwungen, hätte möglichst langsam gekaut und gehofft, dass der schreckliche Moment schnell vorbei geht. Anschließend hätte ich mein schlechtes Gewissen möglichst bald mit viel Sport wettgemacht.
»Es kann motivierend wirken, die Patienten mit ihren Untersuchungsbefunden zu konfrontieren«, sagt Pfeiffer. Oft zeigten sich bereits körperliche Spuren der Krankheit: Der Östrogenspiegel ist zu niedrig, der Herzschlag verlangsamt oder gestört, vielleicht sind sogar schon Organe oder Teile des Gehirns geschädigt. Dann schaut der Oberarzt auf die Uhr und steht auf. »Tut mir leid, aber ich muss noch etwas ausarbeiten. Aber schreiben Sie gerne, dass wir für Spenden immer dankbar sind. Auf Wiedersehen.«
6. ESSEN MIT DEM WANDERFÜHRER
Essen als Therapie gegen Essstörungen klingt nach einer echten Herausforderung. Wie das wohl in der Praxis aussieht? Wie bringt man die positive Seite der Kalorien in die Köpfe der Patienten? Wie nimmt man Essgestörten die Angst vor Fett und Zucker? Auf welche Weise sorgt man dafür, dass sie zu den lustvollen Essern werden, die sie vor der Essstörung waren?
Vera Baumer muss sich diese Fragen täglich stellen: Als Diätassistentin therapiert sie seit 18 Jahren Menschen mit Essstörungen. Außerdem arbeitet sie seit zehn Jahren als Fachleiterin der Ernährungstherapie bei ANAD e. V., einem Münchner Verein, der therapeutische Wohngruppen und ein umfassendes Therapiekonzept für Essgestörte anbietet. »Als ich mich 1993 für meinen Beruf entschieden habe«, erinnert sich die 38-Jährige, »interessierte sich kaum jemand für diese Krankheit. Doch mich faszinierte das Thema. Und ich hatte nach meiner Ausbildung tatsächlich das Glück, eines der ersten Programme für Essgestörte am Max-Planck-Institut in München mit aufbauen zu dürfen.«
Es macht Spaß, Frau Baumer zuzuhören, unser kurzes Telefonat entwickelt sich zu einem eineinhalbstündigen Gespräch. Sie hat eine optimistische und liebevolle Art, über ihre Arbeit zu sprechen. Die Ernährungstherapeutin macht ihren Patienten von vornherein klar, dass sie persönlich nichts von ihnen fordert. Sie versucht, Orientierung anzubieten, ohne die Patienten unter Druck zu setzen. Baumer und ihre Kolleginnen verbringen den ganzen Tag in Wohngruppen. Sie bereiten das Frühstück zu, sie kochen und essen gemeinsam mit den Patienten. Es geht zuerst einmal darum, dass die Patienten überhaupt selbstständig essen. Und es gibt keine allgemeingültige Vorgehensweise, um dieses Ziel zu erreichen.
In Einzelgesprächen versucht die Ernährungstherapeutin die Patienten kennenzulernen und herauszufinden, welche Methoden ihnen helfen könnten. Manche empfinden es als Erleichterung, sich nach einem Essensplan zu richten. Der Plan kann den Patienten vorübergehend die Verantwortung abnehmen, normal oder richtig zu essen. Das erleichtert erst mal viele, denn dann müssen sie sich keine Gedanken mehr machen um das leidige Thema. »Ich vergleiche das immer mit einem Stadtplan oder einem Wanderführer, nach dem man sich so lange richtet, bis man den Weg alleine findet«, sagt Baumer. Doch es dauert in der Regel recht lange, bis die Freude am Essen wiederkommt.
In einer zeitlich begrenzten Therapie kann das deshalb oft nur zum Teil, manchmal auch überhaupt nicht vermittelt werden. Rückschläge gehören ebenfalls zum Arbeitsalltag der Münchnerin. Jede Mahlzeit ist eine neue Herausforderung für die Patienten. Es passiert nicht selten, dass jemand lustlos im Essen stochert und damit die ganze Tischgesellschaft runterzieht. Da sei Konsequenz gefragt. »Es hat sich bewährt, jemanden, der nicht isst, von der Mahlzeit auszuschließen«, erklärt Vera Baumer. Man muss den essenden Patienten zeigen, dass es nicht geht, sich innerhalb eines Therapieangebots zu verweigern. Vera Baumer möchte ihr Vorgehen nicht als Härte verstanden wissen - sie betrachtet klare Regeln beim Essen als Orientierungshilfe für die Betroffenen. »Um den Patienten zu helfen, muss man ihnen Klarheit bieten. Es bringt niemanden weiter, bei Tisch zu diskutieren.« Besser ist es, im anschließenden Einzelgespräch über Beweggründe und Probleme zu sprechen.
»Hin und wieder denkt man schon: Nun iss doch einfach, das kann doch nicht so schwer sein«, gibt die Expertin zu. »Aber das ist natürlich Quatsch, denn für die Patienten ist genau das die größte Herausforderung.« Andererseits ist jeder Betroffene für seinen Therapieverlauf selber verantwortlich. Baumer hat sich deshalb angewöhnt, ihren Patienten zu vermitteln, dass sie sich bei jeder Mahlzeit neu entscheiden können. »Diese jungen Menschen haben keine unheilbare Krankheit, sie können bei jeder Mahlzeit selber wählen, ob sie gesund werden wollen. Das ist eine riesige Chance.«
7. TRANSFORMATION
Vera Baumers konstruktive Sicht auf Essstörungen ist gleichzeitig bewundernswert optimistisch und beruhigend pragmatisch. Ihre Taktik erscheint mir im ersten Augenblick hart, doch wenn ich ehrlich bin, habe ich die Krankheit auf ähnliche Weise überwunden. Erst als mir klar wurde, dass sich niemand mehr um mich kümmern würde, wenn ich weiterhin jede Hilfe abblockte, wollte ich wieder normal werden. Ich bekam Angst, bald alleine dazustehen. Gleichzeitig begriff ich, dass nur ich selbst für mein Schicksal verantwortlich war - und dass das Leben zu schön ist, um es freiwillig wegzuschmeißen.

Diese Einsicht war der Anfang vom Ende der Krankheit. Der Weg zu einem normalen Aussehen dauerte einige Jahre, und die Angst, dick zu werden, ist immer noch in meinem Kopf.
Hilfreich, fast therapeutisch, war meine Arbeit als Köchin. Statt mir ständig Gedanken über mich und die Welt zu machen, verfolgte ich das Ziel, eine gute Köchin zu werden. Das Kochen war großartig. Ich lernte viele andere Köche kennen, die ihre ganze Energie und Leidenschaft in den Beruf investierten - zusammen schafften wir jeden Tag ein Arbeitspensum, das eigentlich nicht zu schaffen war. Ich war stolz, zu dieser hart arbeitenden und ein bisschen verrückten Zunft zu gehören. Die Küche gab mir neues Selbstbewusstsein. Zudem gab mir der Beruf Freiheit. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte, gehen, wohin ich wollte. Und ich hatte keine Zeit, über das, was passiert war, nachzudenken.
Heute empfinde ich den Lebensabschnitt meiner Essstörung als interessanten, prägenden Prozess. Er führte zu einer Persönlichkeitsveränderung - eine der etwas krasseren Art. Ohne diese Krise wäre ich mit Sicherheit jemand anders geworden. Es war eine Erfahrung, die mir klarmachte, wie überaus befriedigend, erdig, lustvoll, luxuriös, aber auch essenziell das gute Essen und Trinken ist.
Rätselhaft ist mir heute nur, warum nicht viel mehr Menschen so positiv denken wie Vera Baumer. Die meisten, mit denen ich während meiner Essstörung zu tun hatte, erstarrten in Sorge. Manche waren peinlich berührt und verzogen mitleidig das Gesicht, als stände ein Geist vor ihnen. Ich bin ganz sicher kein Freund von gnadenlosem Optimismus, frage mich aber trotzdem, ob Essstörungen einfacher zu behandeln wären, wenn man sie weniger negativ und ängstlich wahrnehmen würde.
8. DIE EFFIZIENZMASCHINE
Andererseits hilft es natürlich nicht, die dunkle Seite der Essstörungen völlig auszublenden. Sie sind besonders gruselig, weil sie sich vehement und scheinbar unerklärlich gegen die Schönheit des Lebens stellen. Sie zeigen die dunkle Seite unserer bunt dahinrasenden Gesellschaft und offenbaren die Kehrseite eines Lebens im Wohlstand, in dem Körperkult, Egozentrik und grenzenloser Genuss für Werte gehalten werden.
Nie zuvor war es so schwer und so notwendig, sich als Individuum zu inszenieren und zu positionieren. Nie zuvor ergab sich das eigene Ich so konsequent aus der richtigen Lebensweise. Und nie zuvor war die Schönheit des menschlichen Körpers so stark mit Heilsversprechen verknüpft wie heute. Schönheit verspricht Gesundheit, Freude, Zufriedenheit, Reichtum, Glück, guten Sex, kaltes Bier, ein langes Leben und vieles mehr. Sicher, gesellschaftliche Faktoren lösen keine Magersucht aus - aber sie funktionieren als Verstärker.
Wer absichtlich immer leichter wird, passt seinen Körper an eine Umgebung und eine Zeit an, in der alles immer flüchtiger und schneller wird. So zumindest sieht es der Künstler Johannes Wohnseifer, der die Bildreihe The Thin Commandments schuf. Das Phänomen der Entmaterialisierung von Körpern hat ihn 2003 zu seiner Rauminstallation Into the light inspiriert, in deren Rahmen das Werk erstmals gezeigt wurde. In Bildern, Skulpturen, Videos und Schriftzügen stellte Wohnseifer dar, was mit Körpern passiert, die schnellen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind, oder wie sich Baustoffe und Bauweisen bei immer leistungsfähigeren Maschinen und Fahrzeugen verändern.
Und natürlich ging es auch darum, was mit dem menschlichen Körper passiert: Wie ändern wir uns in Zeiten von Ruhelosigkeit, Fast Food und Slim Fast? Am Telefon ist der 1967 geborene Wohnseifer ein ruhiger, sympathischer Zeitgenosse. Er erinnert sich, wie er bei der Recherche zu der Ausstellung zuerst auf Essstörungen und dann im Internet auf die sogenannten Pro-Ana-Seiten gestoßen war: Foren, in denen sich Essgestörte über ihre Krankheit austauschen und gegenseitig bestärken, weiter zu hungern.
Dort fand er die Thin Commandments, einen kleinen Teil des Pro-Ana-Manifestes, das weitere ähnliche Verhaltensregeln umfasst. »Für mich war das faszinierendes Material, das hervorragend zum Konzept passte«, erklärt er. »Die Thin Commandments dokumentieren das radikale Denken Essgestörter. Sie zeigen, wie sich die Selbstwahrnehmung und die Sicht auf die Umwelt unter dem Einfluss der Krankheit verzerren. Und sie demonstrieren, wie der menschliche Körper zu einer Effizienzmaschine wird, wie er konsequent leichter gemacht wird, bis er kollabiert.«
Besonders spannend oder vielleicht auch tragisch ist die Entstehungsgeschichte der Thin Commandments. Die zehn Gebote sind nicht etwa eine Erfindung der Pro-Ana-Szene: Sie stammen ursprünglich von einer amerikanischen Psychologin, die die Gedanken ihrer Patienten aufschrieb, um ihnen ihr verzerrtes Weltbild vor Augen zu führen.
Was aber kann man sonst tun? Ärzte und Therapeuten sind sich sicher, dass man Essstörungen vor allem frühzeitig erkennen muss, um sie erfolgreich therapieren zu können. Sie setzen auf Beratungsstellen und gesundheitliche Aufklärungsarbeit in Schulen. Zudem wird immer wieder gefordert, dass man in Zeitschriften auf Models verzichten sollte oder in der Werbung häufiger normale Menschen zeigen müsse.
Johannes Wohnseifer zweifelt an solchen Ideen. Bei Models gehören Aussehen und Idealmaße zum Beruf, meint er, das wisse jeder und das könne auch jeder abstrahieren. Wenn fortan überall tolle normale Menschen abgebildet würden, würde der Druck nur wachsen, gut auszusehen - dann muss eine Mutter von fünf Kindern auch noch cover-tauglich sein.
9. SCHÖNHEIT
Vielleicht ist das so. Vielleicht aber auch nicht. Schließlich beeinflussen die Bilder von vermeintlicher Schönheit unseren Anspruch an die Realität und wohl auch an uns selbst - vor allem, weil schön fast immer mit glücklich gleichgesetzt wird. Am Ende glauben wir selber, dass nur wer schlank und schön ist, auch glücklich sein kann.

Ich kann nicht mehr sagen, ob ich früher an Schönheitsideale geglaubt habe oder ob solch ein Glaube zu meiner Krankheit beigetragen hat. Wenn ja, geschah das zumindest nicht bewusst. Heute jedenfalls entsprechen Menschen, die ich schön finde, fast nie irgendwelchen Idealmaßen. Das liegt wohl auch daran, dass für mich echte Schönheit nichts mehr mit der äußeren Erscheinung zu tun hat.
Als schön empfinde ich innere Ruhe, Zufriedenheit, Ehrlichkeit und Authentizität - ein Strahlen, das manche Menschen in sich tragen. Es ist die innere Schönheit, die jemanden umgibt. Sie ist leise und nachhaltig - und sie ist mehr als nur ein Versprechen von Glück.
Illustration: Tilo Göbel
www.tilogo.com
Aus Effilee #16, Mai/Juni 2011



Ein wunderbarer Artikel. Als betroffene Mutter bin ich voller Hoffnung, dass sich aus dieser sehr schweren Phase meiner Tochter ein unangepasster Mensch voller Stärke und Achtsamkeit entwickelt.