Sie sind Fernsehköche: Sie schwenken elegant Töpfe und Pfannen unter heißen Scheinwerfern, hacken in Sekunden Schalotten klein, ohne eine Träne zu vergießen, und erzählen dabei auch noch schlagfertig Witze. Sie sind Werbefiguren: Sie zeigen auf Plakaten ihr schönstes Photoshop-Lächeln, ihre Körperhaltung drückt natürliche Autorität aus. Sie sind berühmt: Sie werden auf der Straße angehalten, sie signieren Autogrammkarten und lächeln, wie man es kennt aus dem Fernsehen. Sie sind die neuen Superstars. Und das ist nur der Anfang.
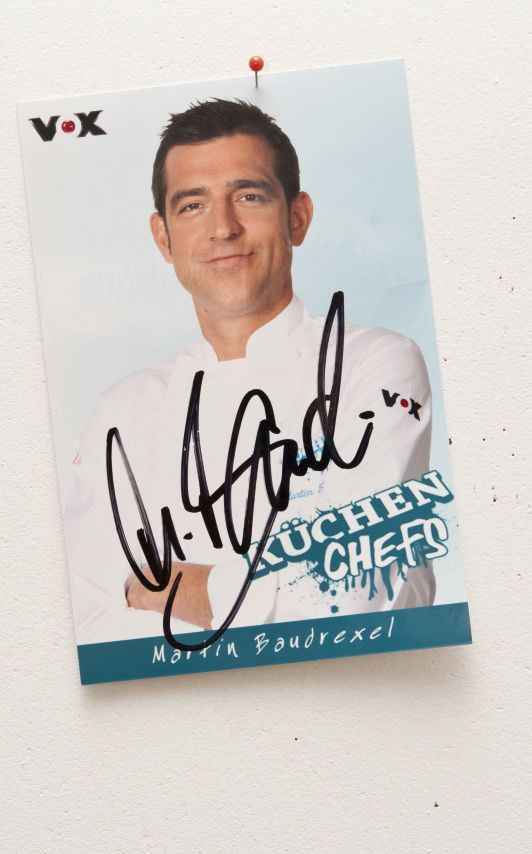
Es gibt viel zu tun. Im ganzen Land kämpfen Restaurants ums Überleben. Küchen versinken im Chaos und Herde im alten Fett, schlecht gelaunte Köche streiten mit schlecht gelaunten Kellnern, Frauen weinen in verlassenen Gasträumen, Männer murren über ungelesenen Speisekarten. Der Laden ist leer, die Stimmung mies, die Angst groß. »Wir haben unsere ganzen Ersparnisse in das Lokal gesteckt«, erklärt ein Besitzer mit gesenktem Blick. Und jetzt? Keine Sorge, jetzt wird alles gut - denn jetzt kommen die Küchenchefs!
Im Küchenchef-Mobil fahren die Köche Ralf Zacherl, Mario Kotaska und Martin Baudrexel an einem leicht bewölkten Tag vor einem betroffenen Lokal vor - schon das Einparken wirkt bei ihnen dynamisch. Und dann retten sie in drei Tagen das Restaurant: Sie zeigen den Köchen, wie man Küchen organisiert, erklären den Kellnern, wie man mit Gästen umgeht, erinnern aber vor allem alle Beteiligten an eine Grundregel: Ihr müsst miteinander reden! Probleme besprechen, Sorgen teilen, zusammen Lösungen suchen. Kurz: Kommunikation ist wichtig. Und das funktioniert: Drei Tage später ist das Lokal voll, das Essen besser und alle sind glücklich - natürlich auch, weil das Fernsehen da ist.
So funktioniert die Doku-Soap Die Küchenchefs auf Vox. Und wahrscheinlich gibt es Menschen, die nun sagen: Was für ein Schwachsinn! Martin Baudrexel, einer der Küchenchef-Köche, sagt dagegen: »Bei Küchenchefs ist wirklich alles echt. Wir sind Köche, keine Schauspieler, und wir lassen uns nicht verbiegen. Das Einzige, was wir manchmal tun, ist Sachen zu entechten: dass wir Sachen nicht zeigen, weil wir denken, dass das dem Betrieb schaden könnte.«
Martin Baudrexel ist 40, sieht aber jünger aus, rosig geradezu. An diesem Tag liegt das wohl auch daran, dass er unter Adrenalin steht, denn er ist im Stress: In seinem Restaurant Isargold in München-Haidhausen ist ein Mitarbeiter krank, nun muss er kurzfristig 20 Personen bekochen - während er zugleich einen Interviewtermin mit Effilee hat.
Was die Küchenchefs den Crews der bedrohten Lokale vermitteln, ist auf jedes beliebige Team übertragbar: in Kfz-Werkstätten, Pflegeheimen. Garten-Center. Damit ist die Serie eine Form der klassischen Aufklärung, über die der Philosoph Immanuel Kant schrieb: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.« Man muss den Weg zu diesem Ausgang manchen Menschen zeigen - und das können Köche genauso gut wie, sagen wir mal, Insolvenzverwalter. Im Fall der Restaurants wohl sogar besser.
Martin Baudrexel: »Uns geht die Sendung so leicht von der Hand, weil wir selber lange Zeit Betriebe haben oder hatten. Wir sehen die Fehler, weil wir sie selber schon gemacht haben. Und wir wissen genau, wie junge Leute ticken, wie Chefs ticken…« Ein Spitzenkoch sollte mehr im Kopf haben als seine Teller. »Es geht nicht nur um Handwerk. Man kann noch so genial kochen: Wer mit seinem Team nicht zurechtkommt, ist kein guter Koch. Es ist ganz wichtig, dass man kommunizieren kann.«
Baudrexel hat selber einen weiten Weg hinter sich: Bereits mit 16 arbeitete er als Spüler, und weil er die Atmosphäre in der Küche mochte, jobbte er auch während seines Musikstudiums in Kanada weiterhin in Restaurants. Nach zwei Semestern gab er das Studium auf und lernte Koch, 2002 kehrte er nach Deutschland zurück. In München wurde Baudrexel Küchenchef im Rubico, das er nach nur einem Jahr übernahm - sein Ex-Chef arbeitet für ihn heute als Restaurantleiter.
Zum Fernsehen kam der gebürtige Münchner kurz darauf über seine Managerin Manuela Ferling, die ihm auch seinen bisher größten Werbevertrag besorgte - für Rama Cremefine. »Ich stehe ohne Wenn und Aber hinter dem Produkt«, sagt Baudrexel. »Außerdem gab mir der Spot die Gelegenheit, mir einen Traum zu erfüllen: mein zweites Restaurant.«
Das Isargold hat Baudrexel Mitte vergangenen Jahres eröffnet. »Das war ein totaler Schrotthaufen«, sagt er. Er hat viel investiert, nicht zuletzt in eine komplett neue Küche. »Ich wäre wahrscheinlich richtig wohlhabend, wenn ich nicht die beiden Läden hätte. Aber das Leben als Koch ist mir wichtig. Ich habe auch den zweiten Laden eröffnet, damit ich ein Team habe, damit ich ausbilden kann, damit ich ein Zuhause habe.«
Deshalb will er im Moment neben den Küchenchefs kein neues TV-Format. »Ich bin heilfroh, dass ich den Fernsehjob habe, so komme ich mal raus: Ich möchte nicht mehr jeden Tag in der Linie stehen, das mache ich schon zu lange. Aber die letzten drei Wochen hatten wir Drehpause, da war ich jeden Tag hier - und das war wie Urlaub für mich.«
An weiteren Werbeverträgen, sagt Baudrexel, sei er nicht interessiert, auf Messen und für Veranstaltungen werde er aber weiterhin kochen. »Meine Läden laufen zwar, aber dank der Nebeneinnahmen kann ich mich darauf verlassen, dass ich die Löhne auch zahlen kann, wenn mal etwas nicht funktioniert. Meine Leute kriegen ihr Geld immer pünktlich und wenn die Spülmaschine kaputt ist, kann ich sie sofort reparieren lassen.«
So kann man also heute als Koch in Deutschland leben, ohne reich geboren zu sein: mit zwei Restaurants, einem abwechslungsreichen Alltag, gutem Einkommen und sogar Privatleben - Martin Baudrexel und seine Freundin denken auch über Kinder nach. Das ist verdammt weit weg vom Klischee des klassischen Kochs, der Tag und Nacht unterbezahlt in stickigen Küchen knechtet und in seiner Freizeit mit anderen Köchen rumhängt, die ebenfalls keine Zeit haben für Freunde. Sicher, Baudrexels Leben ist kein Durchschnitt - aber auch nicht einmalig. Es gibt wesentlich extremere Erfolgsgeschichten.
Tim Mälzer zum Beispiel, quasi das Gesicht der Neuen Deutschen Köche: Ständig ist er im Fernsehen, von Büchern und Zeitschriften lächelt er seinen Fans gephotoshopt entgegen, inzwischen macht er sogar Werbung für Wandfarbe, die nach einem Rezept(!) gemischt wird. Man könnte das für den Triumph der Mediengesellschaft halten: Bist du im TV, bist du wer.
Andererseits gibt es aber auch Harald Wohlfahrt, Drei-Sterne-Koch und seit Langem als einer der besten Köche Europas bekannt: Er macht Werbung für Gubor-Schokolade, kocht für die Europäische Raumfahrtbehörde ESA Weltraumessen, kreiert für das Event-Restaurant Palazzo Menüs - und dreht keine Kochshows.
Viel Fernsehen und kein Stern, viele Sterne und kein Fernsehen - beide Positionen funktionieren. Nur ihr gemeinsamer Nenner, das Interesse des Publikums, liegt im Nebel: irgendwo zwischen gestiegenem Interesse an Essen, neuer Lust am Kochen und wachsender Popularität von Kochsendungen. Die üblichen Verdächtigen - wobei alle ebenso Ursache wie Wirkung sein könnten. Deshalb fällt dann gerne das Wort: Trend. Passt immer, heißt nichts.
Versuchte man, ernsthaft die Gründe für die Neuen Deutschen Köche zu finden, stände man vor einem Gestrüpp aus Überflussgesellschaft und Zeitmangel, Reizüberflutung und Sehnsucht nach sinnlichem Erleben, Angst vor Entfremdung und Angst, etwas zu verpassen. Darin zu wühlen kann man gut lassen, doch zumindest eine beliebte These sollte ausgeräumt werden: Das Fernsehen ist schuld.
Fernsehköche gab es schon immer, angefangen bei Clemens Wilmenrod, dem ersten Fernsehkoch in den 50er-Jahren, der übrigens kein Koch war, sondern Schauspieler. Wilmenrod war ein Star, Wilmenrod schrieb Bestseller, Wilmenrod beglückte Deutschland mit dem Toast Hawaii - einen Gourmettrend brachte er trotzdem nicht in Gang. Lag es an der Dosenananas? Aber auch seine Nachfolger Ulrich Klever, Max Inzinger oder Hans Karl Adam, der es immerhin auf 80 Kochbücher brachte, machten aus der Bundesrepublik keine Genusslandschaft.
Nein, da ist es überzeugender, die ganze Sache Manuela Ferling anzuhängen. Die 49-Jährige sieht auf den ersten Blick harmlos aus, doch als vor unserem Gespräch ihr kleiner Hund zum Gassigehen abgeholt wird und sie sagt: »Bine muss jetzt in den Kindergarten«, merkt man, dass diese sehr bestimmt auftretende Frau auf eine leicht schräge Art echt verwegen ist.
Ferling hat früher für Yamaha gearbeitet, Motorräder, Rennsport, sie fuhr auch selber, aber »nie wieder« - auf dem Arm hat sie eine Narbe. Irgendwann fing sie an, sich mit Gastronomie zu beschäftigen, und da kam ihr ein Gedanke, der heute simpel klingt, den bis dahin aber niemand hatte. »Meine Idee war, den Koch nach vorne zu stellen. Der Koch ist ein Mensch, damit können alle etwas anfangen. Man kann über ihn Geschichten erzählen und so die Leute an das Thema Essen heranführen.«
Das war Ende der 90er-Jahre, eine völlig andere Welt. Die aufregendste Kochshow war Kochduell auf Vox, einem Sender, der etwas populärer war als TM3. Erinnert sich noch jemand an TM3? Jenseits der Sternegastronomie, für die sich eine winzige Minderheit interessierte, waren Restaurants gut, wenn das Essen lecker war und die Teller voll - Köche nannte man die Leute, die dafür zuständig waren. Was zählte, war das Essen.
Das innovativste Phänomen in der deutschen Gastronomie waren zu dieser Zeit Die Jungen Wilden, eine Vereinigung junger Köche, die alle Regeln brechen wollte, auf ihrer Website aber auch nicht über den Tellerrand hinauskam: »im mittelpunkt steht das erleben außergewöhnlicher küche und nicht das wo, worauf, worin oder von welchem löffelchen (…) verrückte kombinationen und ungewöhnliche gar- und präsentationstechniken prägen den stil der jungen wilden.« Alles in konsequenter Kleinschreibung. Wie bei der RAF.
Doch Manuela Ferling gefiel die Initiative der Köche, sie sah Potenzial, dem nur die Richtung fehlte, und meinte, die liefern zu können. Sie versuchte sich als Managerin der Jungen Wilden, aber das war ein Stamm mit 20 Häuptlingen, und so konzentrierte sie sich mit der Zeit auf einzelne Köche: Björn Freitag, Ralf Zacherl, Kolja Kleeberg, Tim Mälzer und so weiter.
Mälzer wurde mit ihr zum Superstar. 2005 wollte er ein eigenes Management in Hamburg, und »das war auch okay so. Das hatte Ausmaße angenommen, es war eigentlich Arbeit für eine Vier-Personen-Agentur. Ich habe 16 Stunden pro Tag geschuftet.« Heute repräsentiert Ferling mit ihrer Agentur Kochende Leidenschaft rund 40 Köche sowie einige Spezialisten aus dem gastronomischen Umfeld und ist damit die erfolgreichste Gastro-Managerin Deutschlands. Was umso bemerkenswerter ist, da sich ihr Büro immer noch im Keller ihres Reihenhauses in einem Kölner Vorort befindet und sie nur eine einzige Mitarbeiterin hat, Frau Kruse. Ein Goldstück!
»Meine Durchschnittsfrau«, sagt Manuela Ferling, »ist die Erna Schlichterdings in Waltrop. Die denkt, Steinbutt ist ein Sternzeichen. Und sie sagt: Steinbutt? 50 Euro? Sind die bekloppt?« An dieses Publikum muss man denken, und das meint sie überhaupt nicht abwertend, im Gegenteil. Schließlich ist sie selber auch nicht mit goldenen Löffeln aufgewachsen. Manuela Ferlings Vater war Koch, ihre Mutter half in der Küche, ihre Tante hatte eine Kneipe. Dort stand sie als kleines Kind auf einem Stuhl und spielte am Spielautomaten, den Gewinn steckt sie in die Musikbox, sie tanzte den Leuten vor und nahm dafür Geld, was dann wieder im Automaten landete. Außerdem machte die Tante die besten Frikadellen. »Ich kannte eigentlich nur gutes Essen. Einfaches, bodenständiges, gutes Essen.« Heute ist ihr Vater stolz auf sie, weil sie Köche bekannter macht.
Das ist ihr größter Verdienst: Manuela Ferling hat das gute Essen ins Volk geholt. Wahrscheinlich brauchte es genau so eine Person, die ein wenig an die klas- sischen Manager in der Popmusik erinnert: Bevor Pop zu einem Riesengeschäft wurde, als es noch ein Spaß war, der weder besonderen Status noch enorme Gewinne versprach, waren auch die Manager schräge Vögel, die ihrem Instinkt folgten anstatt dem Rezept für den perfekten Hit. »Am Anfang«, sagt Manuela Ferling, »muss jeder Koch erst mal bei mir ein Schnitzel machen. Und ich gucke, wie das ist und wie hinterher die Küche aussieht.«
Längst macht sie keine Werbung mehr für sich, die Bewerber kommen von selber. Viele Köche können sich aus ihrem Alltag ausklinken, ihre Küche läuft, nun wollen sie mehr. »Manche möchten ins Fernsehen, andere Bücher schreiben oder Kochkurse veranstalten. Nur, wenn einer kommt und sagt, ›mach aus mir einen Star‹, schicke ich ihn wieder nach Hause.«
Doch man muss nicht unbedingt ein Star werden, um vom Boom der Neuen Deutschen Köche zu profitieren. Man kann Kochkurse geben, sein Restaurant mit ungewöhnlichen Konzepten aufwerten, bei Events kochen, Catering versuchen. Denn eines hat der Boom allen Köchen gebracht: Man betrachtet sie nicht mehr wie einfache Handwerker, auf der Stufe von Klempnern, sondern eher als Künstler, angesehen und respektiert.
Was allerdings auch Nachteile hat. In den bürgerlichen Medien haben die Starköche in den vergangenen Jahren immer wieder Prügel bezogen, was auch mit ihrer neuen Rolle als Künstler zu tun hat: Von Kreativen, die mit hehren Werten und ewiger Schönheit zu tun haben, wird eben verlangt, dass sie edel und rein, also so unkommerziell wie möglich sein sollen. Künstler dürfen Werke verkaufen, Köche Essen - alles andere ist pfui.
Deshalb schwingt in allen Gesprächen, die ich zu diesem Text führe, ein leichter Unterton des Misstrauens mit. Vor allem, wenn es um Werbung geht. Wobei es ohnehin schwierig ist, darüber offen zu sprechen. Werbeverträge sind mächtige Werke, in denen vieles festgelegt ist, auch Sprachregelungen. Wenn ein Werbeträger sagt, er stehe hinter einem Produkt, bedeutet das nichts - das muss er so sagen, dass steht in jedem Vertrag. Andererseits erklärt das nicht die Wut, die den Köchen für die Reklame entgegenschlägt.
Manuela Ferling erzählt: »Es gab viele Reaktionen auf Kooperationen meiner Köche, zum Beispiel auf Kolja mit Lidl. Ein Journalist einer sehr angesehenen Zeitung hat mir mal gesagt, dass er es schlimm findet, dass es überhaupt solche Discounter gibt.« Ein anderer Koch soll wegen einer Werbung sogar verprügelt worden sein. »Die Endverbraucher haben mehrheitlich sehr positiv auf die Zusammenarbeit reagiert. Die Medien haben zum Teil Verständnis für Koljas Schritt gehabt, einige meinten aber auch, dass das mit seinem Status als Sternekoch nicht vereinbar sei.«
Es wäre ein großer Fortschritt, wür- de man in den Medien über den Wert von Discountern und Industrieprodukten streiten - und die Werbung der Starköche wäre dafür ein guter Anlass. Nur wurde das jenseits dümmster Klischees, »da ist Glutamat drin!«, nicht getan - wohl auch, weil die Medien mit genau dieser Werbung Geld verdienen. Also muss stattdessen der Bote dran glauben. Für den Spitzenkoch, den Künstler und die Jungfrau Maria gilt: Unbefleckt sollt ihr sein - alle machen für Geld die Beine breit, ihr aber bitte nicht.

Schaut man genauer hin, fragt man sich allerdings: Was soll’s? Ein Koch, der Tütensuppen bewirbt? Das ist natürlich Schwachsinn. Andererseits: Hey, das ist Horst Lichter! Der war mal Koch, aber der hat umgelernt auf Kochdarsteller. Oder Johann Lafer: Sahne, Nudeln, Küchengeräte, Scho-kolade - wohin man kommt, Lafer ist schon da. Andererseits: Der Mann sieht aus, als könnte er mit Leitern handeln, dem kauft man alles ab - warum diese Gabe nicht nutzen? Oder Alfons Schuhbeck: Ja, sicher, die Escoffier-Suppen sind bessere Tütensuppen - aber das passt, ehrlich, ich kannbdas beurteilen, ich habe mal was in Schuhbecks Gewürzladen gekauft. Oder Kolja Kleeberg: Lidl ist doch auch nur ein Discounter… Okay, zugegeben, das ist er nicht. Lidl hat einen ganz schlechten Ruf, vor allem als Arbeitgeber. Warum also Werbung für Lidl?
Manuela Ferling sagt: »Ich finde es nicht verkehrt, dass der Kolja für Lidl Rezepte macht und Leute dazu bringt, schöne Sachen zu kochen. Kolja hat seine Ansprüche, er verarbeitet zum Beispiel keine Convenience-Produkte, und Lidl akzeptiert das.«
Einige Tage später antwortet Kolja Kleeberg in Berlin auf dieselbe Frage: Lidl habe zuerst etwas ganz anderes gewollt, Testimonials, also Varianten von: Ich finde Lidl super! Das wollte er nicht, aber dann habe ihm ein Freund geraten: Warum bietest du ihnen nicht etwas an, was du kannst? Damit konnte er leben: »Ich mache keine Werbung für Lidl, ich schreibe Rezepte, in denen frische Zutaten benutzt werden. Mir geht es darum, dass die Leute ganz normale Sachen kochen, das, was ich von meiner Mutter oder meiner Oma gelernt habe. Die sollen sagen: ›Ach, Hefeteig ist nur Mehl, Hefe und Wasser? Das ist ja toll!‹ Es geht darum, den Kunden wieder Spaß am einfachen Kochen beizubringen.«
Wir haben uns in Kleebergs mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant Vau in einem überrenovierten Teil der Berliner Innenstadt getroffen und sprechen nun also über die Kunden von Lidl. »Die Leute kochen nicht, weil sie glauben, sie hätten davon nicht genug Ahnung, kein Geld und keine Zeit«, sagt Kleeberg. »Und das ist Quatsch.« Womit wir wieder bei der Aufklärung wären.
Gerade die Unterschicht, Lidls wichtigste Zielgruppe, isst eher Fertiggerichte als Frisches, mit den üblichen Folgen: Übergewicht, Lethargie, Krankheit, Tod. Nein, falsch, Letzteres nicht, so einfach wird Deutschland seine Hartz-IV-Empfänger nicht los. In England werden inzwischen in Sozialstationen Kochkurse angeboten, weil Selberkochen gesund ist und auf lange Sicht die Krankenkassen entlastet. Der britische Starkoch Jamie Oliver, der einen eigenen Kreuzzug gegen schlechte Ernährung führt, hat bei einer Kooperation mit der Supermarktkette Sainsbury die Zutaten für seine Rezepte im Regal besonders kennzeichnen lassen, sodass bereits beim Einkauf der Griff zur frischen Ware leichter fällt. »Falls es mit Lidl weitergeht«, sagt Kleeberg, »könnte man das dort vielleicht auch machen.«
Wir sitzen kurz vor der Küche, direkt hinter der Küchentür hängt ein Schild: Nicht labern, MACHEN, daneben ein Bild von Jack Nicholson als Psychopath in Shining. Mitten im Gespräch klingelt das Telefon, es ist Kleebergs fünfjähriger Sohn Max, der stolz berichtet, dass er gerade das silberne Schwimmabzeichen geschafft hat. Kleeberg hat drei Kinder, die anderen sind eineinhalb und acht.
Es ist früher Nachmittag, einige Tische sind noch besetzt, letzte Gäste vom Mittagessen, unter anderem eine Geburtstagsrunde. Kleeberg bringt einen Kuchen an den Tisch, ein Präsent des Hauses, und singt ein Geburtstagslied, in das der Tisch schließlich einstimmt. Hinterher erzählt er, wie er einige Tage zuvor das ganze Restaurant dazu gebracht hat, für einen Gast ein Geburtstagsständchen zu singen. »Ich glaube, ich bin auch Koch geworden, weil ich so gerne Gäste habe, weil ich so gerne Gastgeber bin.«
Der 46-Jährige kam als Kind zum Kochen. Er lebte alleine mit seiner Mutter, einer Lehrerin, mit der er jeden Mittag im Gasthaus aß, bis er älter war und zu Hause das Kochen vorbereiten konnte - irgendwann kochte er selber. Doch er wollte nicht Koch werden, sondern Schauspieler, und spielte tatsächlich im Theater in seiner Heimatstadt Koblenz ohne jede Ausbildung einige kleine Rollen. Die Begeisterung dafür merkt man ihm bis heute an, er erzählt plastisch und gerne mit verteilten Rollen. Auf die Schauspielschule schaffte er es allerdings nicht, und als ihm ein Freund von seiner Kochlehre vorschwärmte, zögerte er nicht lange.
Nach Berlin kam er 1993, weil er mit zwei Freunden ein Restaurant eröffnen wollte: »Eine Scheißidee! Fünf Freun- de und das Restaurant, frei nach Enid Blyton? Ich habe noch nie erlebt, dass das funktioniert. Man verliert entweder die Freunde oder viel Geld. Ich habe beides verloren.« 1996 traf er einen Investor, der einen Restaurantchef für ein neues Lokal suchte. 1998 wurde der Investor wegen Betrug verhaftet, und als er drei Jahre später aus dem Gefängnis kam, führte er seine Firma fix in den Ruin. Aber das war nicht schlimm, denn so konnte Kleeberg das Restaurant dem Insolvenzverwalter abkaufen.
»Wenn wir mal das Hehre und Heroische am Kochen außer Acht lassen«, sagt Kleeberg, »ist es einfach so, dass ich ein mittelständisches Unternehmen führe. Und wer würde einem Unternehmer in der freien Wirtschaft untersagen, dass er andere Geschäftsfelder erschließt?«
Für die Kritik an seinen Fernsehauftritten oder die Werbung, die besonders anrüchig sein soll, weil er ein Sternekoch ist, hat er nichts übrig. Die Qualität seines Essens, sagt er, leidet nicht: Er ist viel im Restaurant, und wenn nicht, kann er sich auf seine Crew verlassen. Außerdem macht er alles auch für seine Leute. »Ich könnte es mir doch einfach machen und das Restaurant zumachen. Dann habe ich keine 38 Angestellten mehr und keine 80 000 Euro Personalkosten im Monat, dann habe ich keinen Druck mehr, nur noch Fernsehen und Messeauftritte. Aber es geht nicht zuletzt um die finanzielle Sicherung des Vau. Wenn ich für eine Versicherung einen Kochkurs mache, verdiene ich an einem Tag mehr, als der Laden in derselben Zeit an Umsatz macht.«
Kleeberg ist seit zehn Jahren TV-Koch. Er fing im Sat.1-Frühstücksfernsehen an, wo man ihn in einem Kochbuch der Jungen Wilden entdeckt hatte. 2005 landete er im Köche-Pool von Kerner, zurzeit ist er bei Küchenschlacht dabei und bei Lanz kocht. Mit seinem Bart ist Kleeberg ein markanter Typ, was eine wichtige Voraussetzung für eine TV-Karriere ist. Damit sollte man nicht rumspielen - Kleeberg rasiert, wäre wie Dieter Bohlen mit Vollbart, das macht Dellen in der Popularität.
Natürlich erkennt man ihn auf der Straße, aber Prominenz ist für ihn kein Problem. »Man tut allerdings gut daran, das nicht zu ernst zu nehmen.« Er spricht mit allen einige Worte, getreu dem Motto von Rudi Carrell: Wenn ich jemanden treffe, soll er hinterher das gute Gefühl haben: Oh, ich habe mit Rudi Carrell gesprochen!
Vielleicht ist das ein weiterer Baustein der Neuen Deutschen Köche: Die TV-Köche sind die neuen Volksschauspieler. Sie kommen oft aus einfachen Verhältnissen, sie arbeiten hart und mit den Händen, sie beschäftigen sich mit einer Kunst, die jeder versteht. Und genau wie früher nimmt man es keinem übel, wenn er kein Gustaf Gründgens ist - doch man nimmt es übel, wenn er Gustaf Gründgens sein könnte, das aber nicht will. Kolja Kleeberg lächelt. »Also ich bin eher Willy Millowitsch als Gustaf Gründgens.«
Und wer ist dann Alexander Herrmann? Wahrscheinlich ist schon die Frage falsch: Wenn man mit dem fränkischen Koch spricht, hat man nicht das Gefühl, dass er ist, sondern eher, dass er sich in einem Prozess des Werdens befindet. Was nicht heißen soll, dass der 39-Jährige ein Anfänger sei: Seit 1995 führt er in Wirsberg im Frankenwald Herrmanns Restaurant im Posthotel, das seit 1869 im Besitz seiner Familie ist. Seit 1997 kocht er im Fernsehen, zuerst bei Kochduell, dann in der eigenen Sendung Koch doch, im Moment bei Lanz kocht und Küchenschlacht, genau wie Kolja Kleeberg. Die beiden haben allerdings nicht dieselbe Managerin - der Franke geht einen ganz eigenen Weg.
Wir treffen uns in Bayreuth, in einem Restaurant hinter dem Festspielhaus, das in der strahlenden Sonne aussieht wie ein Kleinstadtbahnhof, der zu allem bereit ist. Herrmann kommt zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Nina Holländer, eine streng wirkende Blondine, mit der er seit einigen Jahren zusammenarbeitet.
Die beiden betreiben die Aha-Effekt GmbH, die sich um die Vermarktung des Kochs und seiner Projekte kümmert, und haben außerdem gerade die Beratungsfirma Koch IQ gegründet. Angesichts dieser Aktivitäten sagt Alexander Herrmann: »Ich habe mich mit der Zeit immer mehr vom Koch zum Unternehmer entwickelt. Bei mir geht es nicht mehr nur ums Kochen als Handwerk, sondern um Kulinarik allgemein. Der Koch ist heute nicht mehr ein reiner Gastronom. Gastronomie ist eine Sparte, aber es gibt viele andere Sparten, die man als Koch auch betreiben kann.«

Der unternehmerische Blick wurde Herrmann quasi in die Wiege gelegt: Seine Eltern waren Hoteliers, schon als Kind erlebte er, wie hart das Geschäft ist. »Wir wohnten alle in Hotelzimmern, aber wenn in Bayreuth Festspiele waren, zogen meine Eltern aus ihrem gro- ßen Zimmer auf den Dachboden, weil wir das Geld brauchten, das der Raum in dieser Zeit einspielte.« Er entwickelte eine Leidenschaft für die Küche, »auch weil ich damit Erfolg hatte«, und ist seit 2008 erfolgreicher denn je: Sein Restaurant hat jetzt einen Stern.
Herrmann ist der kreative Chef der Küche, doch seine Rolle sieht er eher wie Andy Warhol als wie Toulouse Lautrec. Denn die Rolle des Kochs, sagt er, habe sich in der modernen Küche dramatisch verändert. »Früher war der Koch wie der Kapitän einer Fußballmannschaft, der dort spielt, wo er gerade gebraucht wird. Das ist mit den Anforderungen der modernen Küche nicht mehr möglich. Heute sitzt du auf der Trainerbank und musst es schaffen, aus Leistungsträgern ein Team zu schaffen. Die Zubereitungsmethoden sind komplexer, es geht um mehr Details, Zehntelsekunden entscheiden den Geschmack.«
Andererseits: Wer ein gutes Team hat, kann auch mal den Platz verlassen. Früher organisierte Herrmann seine diversen Jobs alleine, doch das wuchs ihm schließlich über den Kopf. »Ich war damals nur am Reagieren«, sagt Herrmann. »Ich bin immer nur den Angeboten gefolgt. Doch ich wollte in eine Position des Agierens kommen und mich mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren.« Also tat er sich mit Nina Holländer zusammen, die früher in einer PR-Agentur gearbeitet hat.
Gemeinsam entwickelte das Duo eine Basis. »Wir haben uns gefragt: Wie sehen wir uns, was passt zu uns?«, erzählt Nina Holländer. »Ein großer Schritt war es, Nein zu sagen.« Das ist für Köche wohl noch schwerer als für andere Menschen, denn sie sind darauf trainiert, Wünsche zu erfüllen. Holländer erzählt von einer Kochrubrik für eine große Frauenzeitung. »Das Format wurde vorproduziert, die woll- ten nur den Namen. Das haben wir dann abgelehnt, obwohl man als Koch eigentlich immer glaubt, dass es gut ist, in den Medien zu sein, weil das Werbung ist.«
Im Vergleich zu den spontanen, intuitiven, irgendwie aus dem Bauch agierenden Köchen, die man so oft trifft, wirken Herrmann und Holländer beunruhigend rational. Das ist der Verlust der Unschuld, genau wie in der Popmusik: Wir schreiben nicht einfach einen Song und hoffen, dass er ein Hit wird, sondern überlegen uns vorher, was funktionieren könnte. Das ist die zweite Welle, die vor langer Zeit auch durch die Popmusik rollte: Nach dem Aufstieg der ersten Superstars, die vom Erfolg überrascht, wenn nicht überrollt wurden, war die nächste Generation nicht mehr so naiv - was nicht automatisch heißt, dass sie weniger enthusiastisch war. Alexander Herrmann ist passenderweise ein Fan von U2, der erfolgreichsten Band der zweiten Welle in der Popmusik.
Wir sprechen über das, worüber ich seit Tagen spreche, und natürlich kennen die beiden alle Klischees der Kritik. Kochshows sind Quatsch, die Leute essen trotzdem Pizza? »Sendungen über Essen sind nicht zwangsläufig Kochsendungen«, ereifert sich Herrmann. »Die Küchenchefs ist eine Doku, viele Formate sind Game-Shows. Beim Sport sagt auch keiner: das ist Sport. Man unterscheidet zwischen Fußball, Leichtathletik, Formel 1. Außerdem glaube ich, dass mehr Menschen nach einer Kochshow kochen, als Menschen nach Sportshows Sport machen.«
Auch Ärger wegen Werbung kennt Alexander Herrmann. Er hat eine Fertigbrühe beworben und bekam dafür reichlich Gegenwind, Stichwort Hefeextrakt, also Glutamat. Das hat allerdings noch eine Vorgeschichte, er hat früher selber in seiner Küche Brühpulver hergestellt und an Gäste verkauft. Dann führte er es in einer Kochsendung vor und kam bald nicht mehr mit der Produktion nach. »Wir haben Bio-Hersteller gesucht, die das für uns produzieren sollten, aber keiner schaffte es ohne Hefeextrakt. Das liegt auch an den Verbrauchern. Das ist einfach ein gelernter Geschmack, den wollen alle.«
Die Kritik an den Kritikern fällt harsch aus. »Wir reden hier nicht über das Produkt«, sagt Nina Holländer, »wir reden über den Hersteller: Unilever. Egal, was die rausbringen, es herrscht erst mal Misstrauen.« Mit dem Problem stehen sie nicht alleine: Das Misstrauen gegenüber Großkonzernen ist enorm, egal ob sie Lebensmittel herstellen, Autos oder Gardinenstangen. Es ist häufig auch berechtigt, als Pauschalverdacht aber natürlich idiotisch. Herrmann ergänzt: »Dabei hätten wir ganz andere Sachen machen können. Wir haben Werbung für Tiefkühlpizza abgelehnt, für Discounter… Aber was wir ablehnen, sieht eben keiner.«
Das also sind die Probleme in der Welt der Neuen Deutschen Köche: ärgerlich, aber nicht existenzbedrohend. Man könnte sagen, Alexander Herrmann hat einen Stern und ist im Fernsehen, der hat gut reden. Und sicher, neben all den Qualitäten, ohne die sowieso nichts geht - Wille, Disziplin, Kreativität, Talent - hatte er auch Glück: Er war zur richtigen Zeit am Start - in dem Moment, als das Interesse an Köchen und gutem Essen plötzlich wuchs und sich damit eine Tür in eine neue Welt der Möglichkeiten öffnete. Doch jetzt ist diese Tür offen und jeder Koch, der sich etwas einfallen lassen will, weil ihm sein Leben zu eintönig ist oder sein Laden nicht läuft, hat eine gute Chance, sein Publikum zu finden. Am Ende zählt nur die Idee.
Was so geht, zeigt Herrmann mit seiner Buchreihe Küchen IQ: Der erste Band, Basis, ist im vergangenen Jahr erschienen, der zweite Band folgt im April. »Das ist«, sagt Herrmann, »kein Kochbuch, sondern ein Buch darüber, wie man in der Küche selber kreativ werden kann. Es geht nicht um Gerichte, sondern um deren Bestandteile, die man variieren und zu Tellern zusammenstellen kann.«
Natürlich ist das Marketing: Schließlich stehen in diesem Buch auch nur Rezepte - die man eben kombinieren kann. Aber dass es bei diesem Duo viel um Marketing geht, ist nicht überraschend - immerhin hat Nina Holländer Werbepsychologie studiert. Es ist auch kein Zufall, dass Herrmann seit 2006 bei öffentlichen Auftritten stets eine graue Kochjacke trägt. Die sieht gut aus, sagt Nina Holländer, und das stimmt, aber sie dient ebenso dazu, die Marke Alexander Herrmann visuell zu prägen. Der Mann könnte natürlich auch einen Bart tragen…
Kein Wunder, dass Herrmann und Holländer gerade die Koch IQ GmbH gegründet haben, ein Beratungsunternehmen, das Konzepte für Industriekunden anbieten wird: Produktentwicklung, Vermarktung und so weiter, Rundumpakete für alles, was mit Essen und Genuss zu tun hat. Die Werbepsychologin und der Koch - für diesen Job ein Killerteam.
Meine Damen und Herren, schnallen sie sich bitte an, wir verlassen jetzt die geschützte Zone. Wir verlassen die kleinen Restaurants, in denen der Maître für ausgesuchte Kunden ungeahnte Meisterwerke erschafft. Wir verlassen die Gourmets mit ihrem Geheimwissen und ihrer Geheimsprache, wir verlassen die klare Trennung der kulinarischen Klassen, wir verlassen den Glauben an Authentizität. Wir befinden uns nun in der Zone der Möglichkeiten, in der es bald alles geben wird, was wir uns vorstellen können, und mehr: Köche, die wie Agenten für die Nahrungsmittelindustrie arbeiten, neben Köchen, die auf Reinheit, Klarheit, Wahrheit bestehen, Superstar-Köche und Independent-Köche, Köche, die nichts tun als kochen, und Köche, die niemals kochen.
Die gute Nachricht ist: Es ist die Zone, in der Köche eine Wahl haben. Die schlechte Nachricht ist: Man kann sich nicht mehr hinterm Herd verstecken, man wird nicht automatisch geliebt, weil man lecker kocht, und man kann größere Fehler machen, als Fleisch zu übergaren. Die wichtigste Frage lautet nicht mehr: Was kann ich? Sondern: Was will ich? Hurra, die Welt der Köche wird erwachsen!
Alexander Herrmann bringt mich zum Bahnhof, die Sonne glitzert auf dem Schnee, wir sprechen über Kinder. Seine Älteste ist 13, die kommt jetzt in die Pubertät, vielleicht wird es mit ihr nun schwieriger, aber »bisher wurde es eigentlich jeden Tag einfacher«. Kolja Kleeberg hatte erzählt, dass er manchmal mit seiner Band auftritt, Martin Baudrexel hat in Kanada Percussion studiert und liebt südamerikanische Musik. Falls er mal Kinder hat, wird er wohl mit ihnen trommeln. Kleeberg spielt seinen Kindern garantiert Lieder auf der Gitarre vor. Herrmann fährt mit seinen Kindern stattdessen wahrscheinlich Schlitten, das kann man hier besser als in München oder Berlin.
Am Bahnhof steige ich aus. Herrmann sitzt in seinem Porsche Cayenne und telefoniert. Er ist ein Koch und er ist frei, er kann machen, was er will, und es gibt viel zu tun.
Bilder: Vox / Kolja Kleeberg / Aha-Effekt GmbH
aus Effilee #15, März/April 2011
2 Kommentare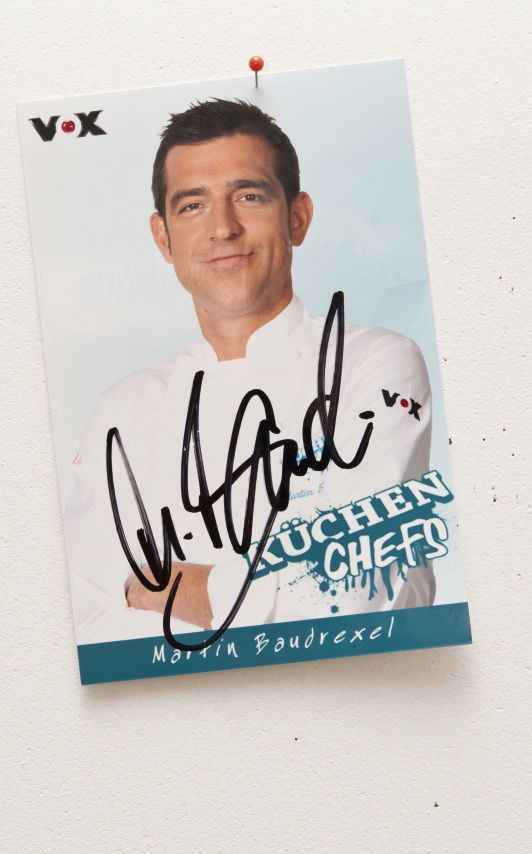


Schön und gut. Nach eingehender Recherche werden die TV-Sender sich für diese Formate entschieden haben, weil die Menschheit sowas sehen möchte. Das kann ich akzeptieren.
Was mir als ambitionierten Hobbykoch und Genußmenschen jedoch bös aufstößt, ist die Tatsache, dass einige der „neuen Superstars“ das Portemonaie scheinbar nicht voll genug kriegen können. Auf der einen Seite wird in den TV-Shows gepredigt, natürliche Produkte zu nutzen und auf Convenience- und sonstige [perversen] Industrieprodukte zu verzichten, auf der anderen Seite kommt dann mit schöner Sicherheit in der Werbepause besagter TV-Shows ein Werbespot zum Beispiel über ein ganz tolles, fettreduziertes [Industrie-] Produkt, was wie Sahne aussieht, wie Sahne schmeckt, wie Sahne eingesetzt werden kann aber alles andere als Sahne ist. Das ganze wird dann mit einem der „neuen Superstars“ garniert und schon ist der Verkaufsschlager beim Kunden im Hirn eingebrannt. Sehr schade und für mich ein klassischer Fall der Doppelmoral! Wasser predigen und Wein trinken ist besonders komfortabel, wenn es mit einem schönen Scheck serviert wird. Mahlzeit!
P.S.: Ich LIEBE meine Schlagsahne!
Vielen Dank für den wirklich sehr aufschlussreichen Artikel! Der Blick hinter die Kulissen des „Kochshowgeschäfts“ hat mir viele neue Einsichten gebracht und auch einige alte Vorurteile gegenüber meinen lieben Kollegen bestätigt.