In Friedrichskoog heißen sie Krabben, im benachbarten Büsum Granat, deutschlandweit kennt man sie als Nordseekrabben. Sie zu fangen ist eine harte, aber profitable Arbeit. Doch für Stefan Schneidereit ist es mehr als ein Beruf. Sein Großvater und sein Vater waren Fischer, sein Sohn will auch einer werden. Wenn er morgens um halb fünf hinausfährt, begleitet ihn nur sein Helfer Marcel

Spätsommer 1972. Ein junger Vater schiebt seinen etwa halbjährigen Sohn die Pier des Friedrichskooger Hafens entlang. Er füttert ihn mit frisch gepulten Krabben, die der Nachwuchs mit sichtlichem Vergnügen verputzt. Der Vater murmelt »mein eigen Fleisch und Blut«, pult noch eine Handvoll Krabben und schiebt weiter zum Wochenendhaus des Schwagers. Ein Spätsommerabend 2010. Ich stehe in der Abenddämmerung an der Pier in Friedrichskoog, nahe der Elbmündung. Das Ferienhaus hat mein Onkel vor Jahren verkauft, der Hafen liegt in den letzten Zügen - er wird dem Land Schleswig-Holstein zu teuer. Doch für den Ort ist der Hafen nicht bloß ein Betriebskostenfaktor, sondern der Mittelpunkt des Lebens, selbst wenn nicht, wie jetzt gerade, das jährliche Hafenfest stattfindet. Überall hängen selbst gemalte Transparente und Schilder, über einen Lautsprecher wird über die Lage informiert: Friedrichskoog steht geschlossen hinter seinem Hafen und damit geschlossen gegen die Landesregierung in Kiel.
Ich unterhalte mich mit Stefan Schneidereit. Er ist seit zwanzig Jahren Krabbenfischer und hat die leicht gebeugte Haltung groß gewachsener Menschen, die es gewohnt sind, für jede Unterhaltung den Kopf auf die Höhe der Gesprächspartner zu senken. Von seinem Kutter dröhnt mit der Lautstärke eines startenden Airbus deutschsprachiges Liedgut mit heftigem Wumms. Von der anderen Seite der Pier, aus dem Festzelt, kommt in ähnlicher Lautstärke eine ähnliche Beschallung. In wenigen Minuten beginnt die Wahl der Krabbenkönigin.
Aus dem Hafenbecken steigt der leicht modrige Geruch des Wattenmeers auf. Ich frage Stefan, ob es möglich ist, ihn auf eine Fangfahrt zu begleiten. Ich möchte den Alltag der Fischer kennenlernen, solange es ihn noch gibt. Wir werden uns ohne viele Worte einig. Stefan ist Fischer, kein Redner. In zwei Wochen soll es losgehen. »Fahr aber morgen erst mal bei der Regatta mit. Nicht, dass dir die ganze Zeit schlecht ist. Seekrankheit ist die schlimmste Krankheit. Irgendwann willst du nur noch über Bord springen.« Dann drängt es Stefan und seinen Kumpel Jens zum Festzelt. »Wir gehen schon mal rein. Wir sitzen da hinten, setz dich doch nachher zu uns. Und bring Bier mit.«
Die Folgen einer Hafenschließung sind schwer abzuschätzen. Dirk Eggers, Gründer der Bürgerinitiative für den Erhalt des Hafens, geht von etwa hundert Arbeitsplätzen aus, die mehr oder weniger direkt wegfallen würden. »Aber die Arbeitslosen bezahlt der Bund, das ist dem Land egal.« Wie viele Kurgäste noch nach Friedrichskoog kommen, wenn es den Hafen nicht mehr gibt, kann niemand sagen. »Besonders deprimierend ist die Arroganz der Politik«, sagt Eggers. »Kiel verlangt einerseits durchgerechnete Konzepte, verweigert aber andererseits die Zahlen, die wir zum Durchrechnen brauchen.«
Das Problem ist die Hafeneinfahrt. »Die muss immer wieder ausgebaggert werden, weil sie versandet. Das kostet natürlich Geld.« Dirk Eggers trinkt einen Schluck Cola. »Andererseits läuft die Entwässerung der ganzen Gegend über den Hafen. Wenn der nicht mehr ausgebaggert wird, müsste man ein Pump- und Sperrwerk bauen. Das kostet ebenfalls Geld, nicht nur im Bau, sondern auch im Unterhalt.«
Ich hole mir einen Armvoll Dithmarscher Pilsener und mache mich auf den Weg zu Stefan und Jens. Auf den staubigen Holzbohlen der Tanzfläche drehen potenzielle Krabbenköniginnen ihre Runden. Dieter Voss, der erste Vorsitzende des Fischervereins Friedrichskoog, zieht die Misswahl mit norddeutscher Nüchternheit durch. »So, Nummer 3, 5 und 9 kommen mal zu mir, ihr anderen könnt nach Hause gehen. Danke schön.« Ich frage Stefan, ob er als Kapitän an Bord viel selbst anpacken muss. »Ja, nö, das macht alles er.« Stefan widmet sich seinem Bier. Er, erfahre ich, ist das einzige andere Besatzungsmitglied, sein Helfer. Das nächste Bier lässt nicht lange auf sich warten. Nur Jens trinkt eine Fanta nach der anderen. Ich frage ihn. »Und du, heute abstinent?« »Fanta-Korn«, antwortet er.
Nach einer Weile setzt sich Marcel zu uns, ein junger Mann mit einem freundlichen, offenen Gesicht, verziert von einem blonden Oberlippenbart. Auf seinem Hals prangt ein Krabbentattoo. »Ja, das habe ich mir machen lassen, schau mal.« Er dreht mir seinen Hals zu. »Ich fahre seit drei Jahren mit Stefan raus und habe den ganzen Tag mit Krabben zu tun, da fand ich das ganz schön.« Marcel ist also er. Und Nummer 5 die neue Krabbenkönigin. Irgendwann stehen vor jedem immer zwei Bier, weil es sonst zu lange dauert, bis das nächste kommt.

Das pünktliche Erscheinen zur Regatta wird mit fortschreitendem Abend immer unwahrscheinlicher und wird am nächsten Morgen nur durch einen Schub übermenschlicher Disziplin bewältigt. Seeluft und Krabbenbrötchen leisten Erste Hilfe, doch trotz Sonnenscheins findet die Fahrt in einem wattigen Nebel statt.
Zwei Wochen später fahren Fotograf Andrea und ich um halb zwei nachts im heftigsten Regensturm über leere Straßen Richtung Nordsee. Um vier Uhr sind wir mit Stefan vor seinem Haus in Friedrichskoog verabredet, um zusammen zum Kutter nach Büsum zu fahren. Kurz nach drei sind wir in Friedrichskoog, gehen noch eine Runde am Hafen spazieren und trinken Red Bull, um wach zu bleiben. Ein Generator brummt leise, einige Kutter liegen still im Wasser. In einem brennt Licht, aber niemand scheint an Bord zu sein. Dann fahren wir zu Stefan. Aus der Dunkelheit kommt eine groß gewachsene Gestalt mit einer Kaffeetasse auf uns zu. »Wir holen noch Marcel ab, dann fahren wir nach Büsum. Ihr fahrt mir am besten hinterher.«
Pünktlich um halb fünf gehen wir im Büsumer Hafen an Bord des Kutters, der Hindenburg. Stefan nimmt auf der Brücke Platz. Draußen ist es stockdunkel, drei Monitore leuchten linker Hand: ein Echolot, ein Plotter mit den Seekarten und einer, auf dem SpongeBob und sein Seesternfreund Patrick groben Unfug anrichten. »Die finde ich wirklich lustig«, sagt Stefan. Er richtet die Elektronik für die Fahrt ein, während Marcel an Deck alles klar zum Ablegen macht. »Wir haben neuerdings ein wöchentliches Fangkontingent von 72 Stunden. Dieses Fischen nach Zeit ist nicht so mein Ding, nach Gewicht wäre mir lieber. Da weiß man, was man bekommt. Andererseits lohnt sich die Fahrt so nur für die, die sich wirklich Mühe geben. Das hat auch sein Gutes.«
Das Steuerrad in der Mitte der Kabine ist nur noch Zierde, gesteuert wird seit Jahrzehnten per Knopfdruck, navigiert über Satellit. Die meiste Zeit fährt das Schiff auf Autopilot. »Ich muss nur aufpassen, dass ich nirgends gegenfahre. Oder mit den Netzen hängenbleibe. An den blau markierten Stellen«, Stefan zeigt auf den Monitor, »bin ich schon mal festgehakt. Und an den roten sind andere festgehakt. Wir geben die Stellen untereinander weiter. So ein Netz kostet schließlich Geld.«

Ich hatte gedacht, dass die Fischer um diese Zeit mehr oder weniger um die Wette zu den Fanggebieten fahren, doch außer uns bewegt sich kaum eine Menschenseele. Stefan schaut auf das dunkle stille Hafenbecken. »Nö, die anderen kommen so ein, zwei Stunden später. Aber es gibt da auch keine Probleme, es ist genug für alle da. Doch im Zweifelsfall ist es immer besser, früh zu kommen.« Ich hätte mich in seiner Lage eher für zwei Stunden mehr Schlaf entschieden, aber ich verdiene meinen Lebensunterhalt auch nicht mit Krabbenfang. Marcel hat sich in der Kombüse auf einer Bank lang gemacht, bevor er wieder ranmuss.
Stefan manövriert aus dem Hafen. »Die Strecke fahre ich so oft, da brauche ich nicht mehr hinzusehen.« Die Hindenburg hat er seit fünf Jahren. »Die hat am Boden der Ems gelegen, als ich sie kaufte. Sah derbe aus, war aber alles okay. Ich habe sie in der Mitte verlängern lassen, jetzt gehen sechs Tonnen Krabben rein.« Wir sind aus dem Hafen raus, die rote Linie auf dem Echolot, die den Meeresboden anzeigt, fällt schnell ab. »Heute sind wir nur kurz unterwegs, da wär es schon okay, wenn wir eine Tonne fangen. Zwei wären natürlich besser.«
Kurz unterwegs heißt 18 Stunden. Normalerweise teilt sich Stefan seine 72 Wochenstunden auf zwei 36-Stunden-Fahrten auf. Früher waren sie auch mal mehrere Wochen unterwegs, bis rauf nach Dänemark, immer dahin, wo die Krabben sind. Stefan macht sich in der Kombüse einen Kaffee. »Krabbenfischen ist Glückssache. Wenn da, wo ich hinfahre, welche sind, habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, muss ich woanders hin. Das hat mit Können nichts zu tun.«
Aus dem Fernsehen kennt man Bilder von Fischern, die mit Echolot Fischschwärme orten und verfolgen, doch das geht bei Krabben nicht. »Auf dem Echolot sehe ich, wie tief der Boden ist, aber Krabben kann ich nicht erkennen, denn die sind direkt auf dem Boden.« Stefan zeigt auf den blauen Echolot-Bildschirm mit der roten Linie. »Sandwürmer bilden Hügel, die du manchmal sehen kannst, wenn die Linie hier so huckelig wird. Da sind oft auch Krabben. Aber vielleicht auch nicht.«
Wir fahren Richtung Nordwesten. »Normalerweise fängt man da an zu fischen, wo man vergangene Woche aufgehört hat.« Der Fischer hält, wie die Krabbe, nicht viel davon, Gewohnheiten zu ändern. Wenn sich die Krabbe an einer Stelle vor drei Tagen wohlgefühlt hat, wird sie es vermutlich auch heute tun. Wir fahren an der Vogelinsel Trischen vorbei, Kurs nach Norden, Richtung Süderpiep.

Friedrichskoog hat immer noch die größte angemeldete Krabbenfischerflotte Deutschlands. Doch viele der Kutter liegen meistens in Büsum, weil die Kutter über die Jahre immer größer und schwerer geworden sind. »Das Problem ist, dass so ein Schiff zu tief ist für Friedrichskoog. Der Hafen ist tideabhängig, da weiß ich nie, ob ich am nächsten Tag wieder rauskomme. Ich brauche ein oder zwei über, um aus dem Hafen zu kommen, das kann man nicht langfristig voraussagen.« Über bedeutet einen Dezimeter über dem normalen Hochwasser. »Andererseits ist der Weg von Friedrichskoog zwei Stunden kürzer, wenn ich in der Elbmündung fischen will.«
Stefan legt einen Hebel um. »Außerdem ist Friedrichskoog mein Heimathafen.« Auf die Regierung in Kiel ist er nicht gut zu sprechen. »Die vertuschen, was das Zeug hält. Es gibt eine Studie, dass ein Rückhaltebecken am Hafen bis zu einen Meter bringen würde - und schon zehn Zentimeter würden was nützen. Aber die Studie haben sie nicht rausgelassen.« Ministerpräsident Peter Harry Carstensen hatte er auch schon an Bord, geholfen hat es nichts. »Peter Harry ist überall. Aber mehr als schön reden und uns den Korn wegtrinken tut er nicht.« »
So, ich sage Marcel Bescheid, wir wollen aussetzen.« Er weckt seinen Helfer und lässt die Ausleger mit den Netzen runter. Von Gewichten gezogen sinken die Netze auf den Meeresgrund. Draußen bereitet Marcel alles für den ersten Fang vor. Er wirft die Pumpen an, die Meerwasser in die Schläuche pumpen, und heizt den Krabbenkessel unter der Brücke an. Die Fenster der Brücke beschlagen. Stefan zeigt eine Stelle auf dem Plotter, die auf halbem Weg Richtung Helgoland liegt. »Hier will ich hin. Wenn ich dann was drinhabe, fische ich in der Gegend noch mal hin und her. Sonst muss ich sehen.«
Es ist jetzt halb sieben morgens. Stefan schaut entspannt über das Meer. »Gestern waren auch schon welche draußen, aber die hatten Nordenwind. Das ist kein guter Wind zum Fischen.« Der Wind hat etwas aufgefrischt, der Kutter stampft merklich auf den Wogen. »Bei Nordenwind haben wir oft Kraut in den Netzen. Das merkst du auch schon während die noch unten sind, wenn das so krüselt und das Schiff keine Fahrt macht.«
Wir haben Glück, nach dem nächtlichen Sturm ist die See ruhig und die Luft relativ trocken. Windstärke eins bis drei ist angekündigt, das ist nicht mehr als ein leichtes Schaukeln. Als ich über das Deck gehe, bin ich trotzdem froh, wenn ich mich an der Wand abstützen kann. Marcel dagegen bewegt sich, als hätte er festen Boden unter den Füßen. »Ja, an das Schaukeln muss man sich gewöhnen.« Er lacht freundlich. »Sollst mal sehen, wie das erst ist, wenn du wieder an Land bist. Dann denkst du, das Land schwankt.«

Oben auf der Brücke sagt Stefans Gefühl, dass es Zeit ist, die Netze einzuholen. »Sonst sitze ich im Schlupper.« Stefan drückt einen Knopf, die schweren Ausleger fahren links und rechts hoch. Die Netze tauchen aus dem Wasser auf. An ihrem Ende befinden sich die Auffangnetze, die über das Deck geschwenkt werden. Marcel öffnet sie über dem Trichter, der Fang ergießt sich in ein Becken. Dort wird er abgespült und wandert über ein Förderband in eine Sortiertrommel, die Krabben von Fischen und Krebsen trennt. Stefan sieht von der Brücke aus einigen Schlupper, also Schlick, über das Förderband laufen. »Das war jetzt ein bisschen zu weit. Hätte ich zwei, drei Minuten vorher eingeholt, hätten wir nicht die ganzen Muscheln drin.«
Aus der Sortiertrommel werden die Krabben in Körbe gespült, die Marcel sofort in einen Kessel mit kochendem Meerwasser leert. Die gekochten Krabben werden auf einem Rüttelsieb weiter sortiert und wandern von dort auf einen Tisch, auf dem Marcel von Hand letzte Krebse und Muscheln aussortiert. Zwischendurch pult er sich einige Krabben direkt in den Mund. Sein Frühstück.
Durch ein Loch in dem Tisch rutschen die Krabben direkt in Kisten im Kühlraum. Während der ganzen Zeit wird Meerwasser über das Deck gepumpt - alles was daneben fällt, wird gleich über Bord gespült. Als Marcel fertig ist, macht er alles sauber, legt es zurück an seinen Platz und bereitet den nächsten Fang vor.
Auf Sorgfalt wird großer Wert gelegt. Ein Fischer kann es allerdings gar nicht haben, wenn ihm jemand reinreden will. »Neulich mussten wir eine Hygieneschulung machen. 25 Euro sollten wir bezahlen, für 15 Minuten. Und alles, was wir gehört haben, hat mir schon mein Vater erzählt. Aber dafür haben wir einen Zettel bekommen, der uns erlaubt, weiter zu fischen.« Stefan schaut aus dem Seitenfenster auf die Netze. »Natürlich gibt es auch bei den Fischern Schweine, das ist überall so. Ich sag mal, von hundert ist das einer. Aber alle anderen haben darunter zu leiden.«
Früher wurden die Krabben von Fischersfrauen gepult, heute ist das aus Hygienegründen verboten. Stattdessen werden die Krabben nach Polen oder Marokko gefahren. Und zurück. »Dass sie dabei besser werden, glaube ich nicht.« Stefan macht eine Pause. »Gewaschen werden sie da auch. Nach Krabbe schmecken sie dann nicht mehr.« Pause. »Die Hygiene macht uns noch krank.« Stefan rutscht in seinem knarrenden Ledersessel in eine bequemere Position. »Oder sie bringt uns um.«
Aus Brüssel kommen einerseits viele Vorschriften, auf der anderen Seite fallen Marktgrenzen. Man kann nur noch überleben, wenn man sich mit den Großen zusammentut, die gerne die Kleinen gegeneinander ausspielen. »Früher wurde uns immer gesagt: Wenn die Preise fallen, liegt das an den Holländern, die so viel fangen. Und den Holländern wurde gesagt, dass es daran liegt, dass wir so viel fangen. Das war reine Verarsche. Jetzt stehen die Mengen im Fischerblatt und jeder kann sie sehen.«
Die Müdigkeit übermannt mich, ich lege mich unter Deck in die Koje. Das sanfte Schaukeln schickt mich in einen tiefen, festen Schlaf, aus dem ich erst durch das nächste Einholen der Netze geholt werde. Elf, zwölf Mal wird sich die Prozedur in den nächsten 15 Stunden wiederholen. Viel mehr passiert nicht. Ich begebe mich zurück ins diffuse Hellgrau des Tages. Um uns herum bis zum Horizont: Meer. Eine unglaubliche, indifferente Macht. Ich frage Stefan, wie zufrieden er mit dem Tagesverlauf ist. »Nach der Schlacht werden die Toten gezählt.« Er beugt sich über den Fang und schmeißt einen Krebs über Bord. »Aber wenn es so weitergeht, will ich nicht meckern.«
Ich bin erstaunt, wie ruhig und freundlich der Umgang auf dem Schiff ist. Es wird kaum gesprochen, jeder weiß, was er zu tun hat. Es wird auch nie laut, wie man vielleicht erwartet, wenn jeder Handgriff sitzen muss. »Es gibt Kapitäne, die haben schon mal mit ’nem Hammer nach ihren Helfern geworfen«, erzählt Marcel, während ich mit ihm Krabben sortiere. »Manchen kannst du es nie recht machen, die wollen an einem Tag dies und am nächsten das. Und dann fangen sie an rumzubrüllen.« Marcel nickt mit dem Kopf Richtung Brücke. »Aber er ist nicht so.« In diesem Fall ist er Stefan.
Es hat inzwischen angefangen zu regnen. Marcel fischt in Windeseile einige Krebse raus. »Das hat man irgendwann drauf. Da siehst du ganz schnell, was keine Krabbe ist.« All das geht über Bord. Zielsicher greift er ein Stück Fisch heraus. »Darauf muss man besonders aufpassen. Der Fisch könnte anfangen zu gammeln.« Marcel wendet seinen Blick keinen Augenblick von den Krabben. »Ich sehe Stefan häufiger als meine Frau. Da ist es wichtig, dass man sich versteht.«
Fischerei ist in Friedrichskoog Familiensache. »Mein Großvater war Fischer, mein Vater war Fischer, ich bin auch Fischer«, erzählt Stefan. Sein Sohn Daniel will ebenfalls Fischer werden. »Ich sage immer, er soll erst mal Schlosser lernen, das kann nützlich sein mit den ganzen Maschinen. Aber er will nichts anderes.« Das ist nicht selten in dieser Gegend. Es ist ein anstrengender Job und man ist viel unterwegs, aber man verdient auch nicht schlecht. Und man hat keine Kollegen, die mit einem reden wollen. Das ist auch was wert.
Stefan zeigt auf einen dunklen Fleck am Horizont. »Das da hinten, das ist das Wrack von der Ondo.« Die Ondo ist ein Kakaofrachter, der 1962 in der Elbmündung auf Grund gelaufen ist. »Da haben damals Kutter die Kakaobohnen von Bord geholt und nach Hamburg gebracht, damit das Schiff leichter wird und wieder flott kommt. Aber die Ondo ist immer weiter gerutscht und am Ende auseinandergebrochen.« Stefan legt eine DVD ein. Er hat eine Folge Die Krabbenfischer vor Alaska aufgenommen, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Backbord ruhen sich einige Kormorane auf einer Sandbank aus.
Ich frage Stefan, ob es Probleme mit dem Nationalparkstatus des Wattenmeers gibt. »Im Moment nicht. Solange man uns in Ruhe fischen lässt, ist alles okay.« Stefan schaut zu den Vögeln rüber. »Aber manches ist schon seltsam. Die Kormorane dürfen zum Beispiel Aale fangen, die Fischer aber nicht.« Pause. »Und der blöde Vogel steht unter Naturschutz.«
Ich gehe an Deck auf und ab und betrachte das dunkle Nordseewasser. »Das ist eine ziemlich dicke Brühe heute, was?«, sagt Marcel, der gerade wieder aufgeräumt hat. »Aber das ist gut. In klarem Wasser fängst du keine Krabben.« Warum? Marcel blickt weiter ins Meer. »Keine Ahnung. Ist so. Erfahrung.« Auf der Brücke schaut Stefan auf die Satellitenkarte. »Mensch, da wollte ich eigentlich zurückfischen und jetzt ist da ein anderer. Na ja, man kann sich nicht den ganzen Tag freuen.« Er schaut einen Moment intensiv auf die Karte. »Ach was, da ist genug Platz für zwei.«
Die nächsten Stunden verbringe ich damit, möglichst nicht im Weg zu stehen. Nebenbei bleibt mir Zeit, meine Krabbenpultechnik zu perfektionieren. Marcel zeigt es mir genau. »Hier, am dritten Glied von hinten, ist eine Sollbruchstelle. Das merkst du auch, wenn du ein bisschen drückst. Da drehst du etwas hin und her.« Dann kann man das Schwanzende des Panzers ganz leicht abziehen und braucht nur noch das Fleisch rauszuziehen. Hinter dem Kutter liefern sich Möwen ein Hauen und Stechen um die Reste.
In der Abenddämmerung legen wir wieder in Büsum an. Der Himmel sieht aus wie ein gemalter Hintergrund in einem alten Hollywood-Film. Stefan ist mit dem Fang zufrieden, 125 Kisten stapeln sich im Kühlraum. An der Pier stehen Stefans Frau Sabine und sein Sohn Daniel mit einem Nachbarssohn, die den Fang mit einem Gabelstapler ins Lager verfrachten. Andrea und ich fahren Sabine hinterher, zurück nach Friedrichskoog. Wir sind in einer Ferienwohnung untergekommen.
Am nächsten Mittag erwache ich recht erfrischt - ich habe geschlafen wie ein sedierter Seehund. Vor der Tür treffe ich Stefans Kumpel Jens. Ich erzähle ihm von der Fahrt und wie angenehm ich den Umgang an Bord fand. Ich dachte immer, da ginge es anders zu. Jens schaut mich an. »Nö. Da ist er auch nicht der Typ für.« Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob er in diesem Fall Stefan oder Marcel ist. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass das Reden übereinander in der dritten Person ein Zeichen des Respekts ist.
Ich gehe den Deich entlang, bis ich vor der Umbauruine des Hauses stehe, in dem ich als Kind viele Sommertage verbracht habe. Vor mir die kurze Brücke über das Fleet, in dem wir früher Stichlinge mit Keschern und selbst gebastelten Angeln gefangen haben. Über die Brücke des Nebenhauses geht unsere Nachbarin Waltraut, ungefähr achtzig müsste sie jetzt sein. Ich habe sie seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gesehen. Sie mustert mich eingehend. »Mensch, Alexander! Du siehst genau aus wie deine Mutter.« Ich widerspreche vorsichtig. »Aber du hast die gleiche Stimme wie dein Vater.« Na gut …

Waltraut ist in Friedrichskoog geboren und hat nie woanders gewohnt. »Ganz früher«, erzählt sie, »wurden die Krabben noch in der Sonne getrocknet. Und der Gammel, also die ganz kleinen Krabben, wurde direkt vom Hafen mit Loren zur Fabrik gebracht und zu Tierfutter verarbeitet.« Sie könne mir da noch viel erzählen, aber es seien gerade Feriengäste gekommen, um die sie sich erstmal kümmern müsse. Der Himmel bezieht sich rasant.
Matthias Stolberg treffe ich vor seinem Haus. Er war jahrzehntelang Fischer, jetzt lebt er mit seiner Hündin Mary in der Nähe des Hafens. Kurz bevor es anfängt zu gießen, als hätte Thor beschlossen, die gesamte Nordsee über dem Ort auszuschütten, erreichen wir seine überdachte Terrasse. »Ja, die Fischerei in Friedrichskoog. Das ist eine lange Geschichte«, sagt er und streckt sich in seinem Gartenstuhl. Er ist 77, könnte aber gut 15 Jahre jünger sein und strahlt eine unerschütterliche Ruhe aus. »Aber die ist bald vorbei.«
Es gibt Leute, sage ich, auch im Ort, die meinen, die Fischer seien selbst Schuld, wenn ihre Kutter die ganze Zeit in Büsum liegen. »Ach!« Für einen Moment ist die Ruhe weg. »Die sollte man kopfüber in den Hafen schmeißen und absaufen lassen! Die haben keine Ahnung! Ich muss doch dahin, wo die Krabben sind. Die laufen mir nicht hinterher!« Stolberg spricht immer noch im kollektiven Ich der Fischer, obwohl er seit Jahren im Ruhestand ist.
Matthias Stolberg ist hier aufgewachsen, in den späten Fünfzigerjahren fing er an, Krabben zu fischen. Jahrelang war er im Vorstand der Fischergenossenschaft Holsatia. Vor zehn Jahren verkauften die Fischer die Holsatia an ein holländisches Unternehmen. Davon war er nicht begeistert, aber er konnte es nicht verhindern.
»Wenn der Holländer was gefunden hat, wo er glaubt, eine Mark rausziehen zu können, lässt er nicht locker.« Die ersten Übernahmeversuche wurden abgelehnt, aber die Holländer waren schon damals eine Macht. »Wenn wir den Fischern eine Mark geboten haben, haben die eine Mark und fünf geboten für die gleiche Menge Krabben. Dass die einem am Ende damit die Selbstständigkeit abkaufen, war klar.« Genauso klar war, dass irgendwann einer umfällt. »Und wo einer umfällt, fallen viele.«
»In den Siebzigerjahren wollten die uns den Hafen schon mal dichtmachen«, erinnert sich Stolberg. »Damals hatten wir einen tollen Bürgermeister, Alfred Glasser, der mit jedem reden konnte. Der konnte noch was bewegen. Heute kommst du gegen die Landespolitik nicht mehr an.« Ich bin überrascht, wie der ganze Ort zusammensteht. Ein Bekannter, der sich in der Lokalpolitik Dithmarschens auskennt, sagte vor meiner Abfahrt: »Die Bauern und die Fischer da sind sich nicht grün. Die hauen sich auch gern mal einen auf die Glocke, wenn sie aus der Kneipe kommen.« Stolberg schmunzelt. »Wenn der Hafen weg ist, ist das für den ganzen Ort schlimm, auch für die Bauern.« Er schaut ins Leere, in die Vergangenheit. »Das mit den Bauern und den Fischern kann ich aber erklären. Das geht von jungen Jahren an so, von der Tanzfläche. Weil wir einfach besser tanzen können.«

Ich erfahre einiges in diesen Tagen in Friedrichskoog. Auch einiges, was ich besser nicht schreibe. In einem Ort dieser Größe möchte es sich niemand mit dem Nachbarn verderben. Ein falsch verstandenes Wort kann manchmal ausreichen. Oder, wie Matthias Stolberg während eines Gesprächs sagt: »Das schreibst du aber nicht auf. Ich möchte in meinem Alter nicht noch lernen müssen, Marathon zu laufen.« Viele Fischer spielen mit dem Gedanken, sich in Finkenwerder anzumelden. »Wenn Schleswig-Holstein uns nicht haben will, kriegt es auch nicht unsere Gewerbesteuer«, sagen sie. Aber auch damit wollen sie nicht unbedingt zitiert werden. Manche im Ort meinen, man hätte schon längst was am Hafen machen müssen. Andere halten dagegen, dass das ohne Geld wohl schlecht ginge. Aber alle sind sich einig, dass Friedrichskoog den Hafen braucht. Die endgültige Entscheidung fällt Ende des Jahres in Kiel.
Fotos: Andrea Thode
aus Effilee #13, November/Dezember 2010
Ein Kommentar





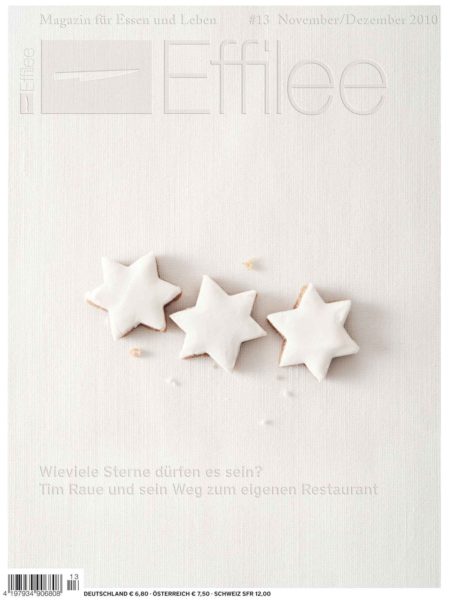
Unglaublich spannend das ganze!