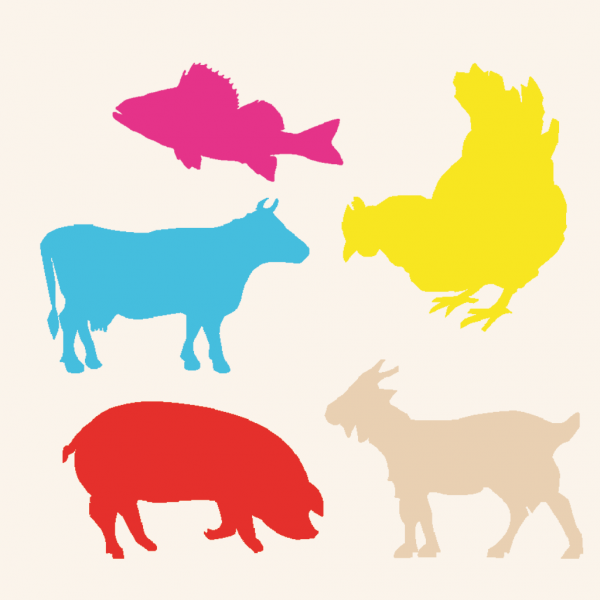
Popel. So nennt die Bäuerin Stache alle Schweine, immer. Ihr Mann sagt nämlich, dass man Tieren, die geschlachtet werden, keine richtigen Namen geben darf. Also heißt das Schwein, das ich mir ausgeguckt habe, jetzt auch Popel. Popel sieht sehr zufrieden aus, abgesehen von einem leichten Sonnenbrand auf den Hinterbacken. Sein bester Freund ist ein vertrockneter Christbaum, den er quer durchs Gehege zerrt. Und wenn Menschen an sein Gatter kommen, steckt er den Rüssel unter den Brettern durch.
Ich schaue Popel zu und denke an Schinken. Und fränkische Bratwurst. Weil wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird Popel das sein. Grausig, irgendwie. Und gleichzeitig ziemlich großartig.
Popel ist die Antwort auf jene Frage, die mich und andere Besseresser umtreibt: Wo kommt eigentlich her, was auf meinem Teller liegt? Wo kommt die Milch in meinem Müsli her? Was für eine Henne hat mein Frühstücksei gelegt? Und wie hat mein Kotelett gelebt, als es noch ein quieklebendiges Schweinchen war?
Natürlich, spätestens seit der Pferdelasagne und den falschen Bio-Eiern haben sich viele des Themas Transparenz angenommen, der TÜV und die Aigner und die Lebensmittelkonzerne sowieso. Die drucken jetzt QR-Codes auf Fertigpizzen. Stichwort Rückverfolgbarkeit und so. Aber irgendwie ist es das nicht. Eigentlich würde ich am liebsten die Henne kennen, die meine Eier legt. Am besten wäre es, wenn ich selbst so eine Henne hätte. Eine Kuh, die meine Milch gibt. Und ein Schwein, das … - nein. Geht nicht. Also geht nicht, weil ich glaube, kein Schwein schlachten zu können. Und geht vor allem nicht, weil ich in Berlin in einer Wohnung im vierten Stock wohne, mit nichts außer einem mittelkleinen, grillvollen Balkon.
Auf dem Blog eines Biobauernhofs fand ich die Lösung für mein Dilemma: eine Patenschaft. Ich könnte, stand da, für 25 Euro die Patenschaft für ein Huhn übernehmen. Einen Google-Nachmittag später war ich die Patin von einem Huhn, einem Barsch, einer Ziege, einer Kuh und eben diesem Schwein, das nun Popel heißt. Meine kleine Telefarm verteilt sich auf ganz Deutschland, vom Voralpenland bis in die Uckermark. Die Tiere sind damit quasi und auf Zeit meins, ich kriege Eier, Käse und Fleisch, muss mich aber weder um Futter und Aufzucht noch den ganzen Dreck kümmern. Klingt nach einer sauberen Sache.
Dachte ich. Bis ich dann mit den geliehenen Gummistiefeln vom Georg Kirchbichler in der Scheiße stehe. Ich versuche angestrengt mit der Brezel warm zu werden. Sie gibt sich spröde. Ich hingegen bin verliebt, war’s ja schon, bevor wir uns in fünf Zentimeter Gülle trafen. Die schwarzen Augen und die wuscheligen Ohren - ein Bild von einem Braunvieh. Deshalb habe ich mir meine Patenkuh auf der Webseite Kuhpatenschaft.de aus einer Datenbank mit rund dreihundert Kühen ja ausgesucht. Brezel geht gern spazieren und mag Mais, stand da - wie ich! Aber irgendwie springt der Funken bei ihr nicht so ganz über. Ich soll mal näher hingehen, meint der Georg Kirchbichler, Landwirtschaftsmeister, Bio-Milchbauer und Brezels Besitzer. »Nur mit den Hörnern musst a bisserl aufpassen.« Ausrutschen wäre auch doof, denke ich, und nähere mich mit Flüsterstimme Feines-Muhli-Blödsinn brabbelnd vorsichtig meiner Kuh.
Die Kuhpatenschaft ist ein Projekt der Andechser Molkerei Scheitz. Zwei Stunden vor meinen Annäherungsversuchen im Kuhstall erzählt mir hoch überm Ammersee die Marketingleiterin Irmgard Strobl, eine entschlossene, junge Bayerin mit Visionen, die sie auch umsetzt, wie das Projekt als Fortführung einer 2009 gestarteten Transparenzinitiative des Unternehmens entstanden ist. Finanziell rechne es sich überhaupt nicht. 87 Euro zahlt der Pate für die einjährige Patenschaft. 27 davon gehen an den Bauern, 50 bekommt der Pate in Waren zurück und 10 Euro sind für den Aufwand der Molkerei veranschlagt, für Versand, Datenbankpflege, ein gerahmtes Foto seiner Kuh, das jeder Pate bekommt, Geburtstagsgrüße und eine Einladung zur Molkereiführung. Um das alles organisatorisch zu stemmen, wurde in Andechs extra eine neue Stelle geschaffen.
Trotzdem lohnten sich die Patenschaften natürlich, erklärt die Managerin, als Marketing- und Kundenbindungstool. Weil sie Nähe schaffen zwischen Erzeuger und Konsument.
Beim Georg Kirchbichler kam neulich ein Porsche Cayenne auf den Hof gebraust. Älteres Ehepaar, Gelsenkirchener Kennzeichen und ziemlich dicke Reifen. Kuhpaten, die einfach mal schauen wollten. Das passiert im Sommer oft, weil sein Hof in Peiting so praktisch auf der Strecke nach Italien liegt, glaubt Kirchbichler. Er hat sie ein bisschen rumgeführt, die Fremden. Bisweilen stellen solche Leute ja komische Fragen, »manche glauben echt noch an die lila Kuh«. Aber die Gelsenkirchener, die waren okay. Trotzdem hat sich Kirchbichler gewundert: Wie kommen Leute von so weit weg und mit so viel PS darauf, Kuhpaten zu werden? »Ach wissen Sie«, habe die Frau da geseufzt, »was sonst soll man einem Mann schenken, der schon alles hat?« Das hat dem Kirchbichler zu denken gegeben. Und irgendwie fand er das auch total gut, sagt er.
Manche Bauern berichten, dass fünf bis sieben Mal die Woche irgendwelche Stadterer zu ihnen kommen. Vor allem, seit man auf der Webseite der Andechser Molkerei mittels MHD recherchieren kann, von welchem Hof die Milch stammt, die für das entsprechende Produkt verwendet wurde (auch wieder Stichwort Rückverfolgbarkeit). Im Grunde sei das ja zu begrüßen, wägt Irmgard Strobl ab, andererseits berge das aber auch so seine Gefahren. Was, wenn Großstadtmenschen mit Landleben-Idyll-Vorstellungen da Sachen sehen, die sie weder sehen sollen noch wollen? Was, nur als Beispiel, wenn da gerade ein Kälbchen im Stall stirbt?
Zwei Wochen später fahre ich zu meinem Huhn. Fast zwei Stunden. Erst Autobahn. Dann Bundesstraße. Dann Landstraße und schließlich einen holperigen Feldweg zum völlig allein auf weiter Flur gelegenen Biohof Weggun in der Nordwestuckermark. An der Tür gibt es keine Klingel, nur eine Glocke. Ich läute, es bellt, ich warte. Und bestaune eben genau dieses Landleben-Idyll. Es ist ein kühler und grauer Frühlingstag. Dramatisch türmen sich dunkle Wolken am niedrigen Himmel über dem Brandenburger Flachland. Einsam hat es mein Huhn hier, denke ich.
Stimmt aber nicht, sagt Marjolein van der Hulst später an einem langen Holztisch in einer Scheune sitzend. Schließlich haben sie und ihr Mann Frank sechs Kinder, vierzig Schafe, über achtzig Hühner, ein paar Katzen und einen Hund, der Bo heißt. Einsam ist anders.
Bis vor fünf Jahren führten die beiden Betriebswirte eine Marktforschungsagentur in Holland. Dann beschlossen sie, ein neues Leben anzufangen und suchten einen Bauernhof mit Stadtanbindung. »Um London oder Paris herum wäre das unbezahlbar gewesen«, sagt van der Hulst. Aber in Brandenburg ging es. »Und immerhin ist Berlin Europas größter Absatzmarkt für Bioprodukte«, also eigentlich perfekt. Jeden Samstag fährt van der Hulst in die Hauptstadt um in der Kreuzberger Markthalle Neun Saft, Obst und Eier zu verkaufen.
Die Hühner brauchen die van der Hulsts zur Schädlingsbekämpfung in der Beerenplantage. »Dafür mussten sie allerdings einen mobilen Hühnerstall haben«, erzählt die Bäuerin. So etwas kostet eine Menge Geld. »Banken wollen immer Sicherheiten und mit kleinen und innovativen Ideen ist es da oft schon schwierig, kleine Beträge zu bekommen.« So kam die Idee mit der Patenschaft. 25 Euro kostet eine Hühnerpatenschaft. Sie läuft ein Jahr und die Paten bekommen in diesem Zeitraum Eier, Marmelade und bald auch Hühnerfleisch im Wert von 27,50 Euro. Oder man nimmt die für 50 Euro, läuft zwei Jahre, gibt Waren für 55 Euro. »Zinsen quasi«, sagt Marjolein van der Hulst, als wir zu dem umgebauten Bauwagen-Hühnerstall laufen.
Kann ich denn sicher sein, dass ich wirklich die Eier von meinem Huhn bekomme, frage ich. Marjolein van der Hulst lächelt höflich. »Ich habe lange darüber nachgedacht …«, setzt sie an, lächelt noch mehr und zuckt mit den Schultern. »Also wenn jemand mit Kind an meinen Stand in Kreuzberg kommt und sagt, er will nur Eier von Berta, dann spiele ich mit. Dann sage ich: Oh, Moment, ich suche schnell die Berta-Eier raus. Aber eigentlich habe ich bewusst darauf verzichtet, jedem Paten ein bestimmtes Huhn zuzuweisen. Ganz einfach, weil ich keinen Paten anrufen müssen möchte, um ihm zu sagen, dass sein Huhn tot ist.« Ihre Brandenburger Freilandhennen leben nämlich in ständiger Gefahr. Von oben. Und aus dem Wald. Greifvögel haben sich schon ein paar Sussex-Rassehühner geholt. »Und vielleicht auch der Fuchs«, sagt van der Hulst und schiebt die Tür des Bauwagens auf. Drinnen gluckst es verhalten und noch ein bisschen müde.
Während ich mich dumm anstelle, ein beliebiges Huhn zu packen (die sind schneller), auf den Arm zu nehmen und mir vorzustellen, das wäre nun meins, erzählt Marjolein van der Hulst von den Qualitäten ihres Hahns. Ein guter Mann, sagt sie, nicht so kratzbürstig wie andere. Dann machen die ersten Hennen sich auf den Weg in die Beerenplantage und finden ein Festmahl: Im hohen Gras liegen die Überreste einer Schwester. Weiße Federn überall, als wäre der Vogel einfach explodiert. Gackernd picken die Hennen die Überreste auf, Fleisch, Blut und Federn hängen ihnen am Schnabel. »Oh«, sagt Marjolein van der Hulst und lächelt vorsichtig. »Mir war so, als hätte da gestern Abend eins gefehlt.« Ein Huhn, das nachts draußen bleibt, ist so gut wie tot, es hat keine Chance. Das ist eben so. Und das mit dem Hennenkannibalismus auch: »Sind nun mal keine Vegetarier«, sagt sie und lächelt immer noch zaghaft, als wäre ihr das alles ein bisschen peinlich. Das ist wohl jetzt so eine Situation, wie Irmgard Strobl in Andechs gemeint hat: Was der Pate aus der Stadt nicht unbedingt sehen soll.
Mich hat das verunglückte Huhn nicht weiter traumatisiert, natürliche Sache, irgendwie. Trotzdem denke ich auf der Rückfahrt durch den Brandenburger Regen über das Sterben nach. Es geht sehr oft darum auf meinen Reisen zu den Patentieren.
Die Frage mit dem Tod ist eine der häufigsten, kniffligsten und - auch wenn das keiner zugeben will - nervigsten Stadtmenschen-Fragen überhaupt. Das ist so süß, muss das wirklich sterben? Oder: Wie können Sie das denn umbringen? Fakt ist: Jedes meiner Tiere wird - so es nicht der Bussard holt - früher oder später geschlachtet und gegessen. Jedes.
Der Barsch stirbt sogar mit einer Party. Im Herbst findet ein großes Barsch-Barbecue statt, bei dem einhundertfünfzig Patenbarsche gleichzeitig auf den Grill geschmissen werden. Der Barsch ist Teil eines ambitionierten Projektes namens Efficient City Farming (EFC), das sich - ganz grob - so beschreiben lässt: In einem Gewächshaus auf einem Firmengelände in Berlin-Schöneberg gedeiht oben in der Sonne Gemüse, unten im Schatten tummeln sich Barsche in einem Tank. Dazwischen läuft Süßwasser, einmal aus dem Fischtank durch Bio-Filter und zurück, und einmal nach oben zur Tröpfchenbewässerung der Pflanzen. Mit sehr wenig Wasser, Kosten und Aufwand entsteht so sehr viel Nahrung. »Das Projekt ist eine Antwort auf die Frage, wie in der Zukunft große Städte möglichst umweltschonend ernährt werden können«, sagt Christian Echternacht, einer der vier Gründer. Der Barsch ist dabei die Idealbesetzung: Aus 1,2 Kilo Futter produziert er 1 Kilo essbares Fleisch. Nur zum Vergleich: Eine Kuh muss dafür 137 Kilo Futter zu sich nehmen.
Die Berliner Barschpatenschaften gab es letztes Jahr schon einmal. Und weil Christian Echternacht der Einzige der EFC-Macher ist, der einen Angelschein hat, war es damals an ihm, alle einhundertfünfzig Fische aufzuschlitzen. »Das war schon komisch«, sagt der Mann, der mal Medizin studiert und mal eine Internetagentur gegründet hat. »Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass mich das einigermaßen kalt gelassen hat. Die Beziehung Mensch-Fisch ist dann doch nicht so ausgeprägt wie die zu anderen Tieren.« Und das, obwohl sich einige Paten nicht daran gehalten haben, Tieren, die geschlachtet werden, keine Namen zu geben. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner etwa hatte ihren Patenbarsch Nepomuk genannt. Mein Barsch heißt Wanda. Wir sehen uns im September wieder am beziehungsweise auf dem Grill.
Popel, mein fränkisches Landschwein, erwarte ich für November portioniert und küchenfertig. Anfang Mai sitze ich im Büro des Metzgers Robert Prosiegel in Mark Berolzheim in Altmühlfranken, der es für mich schlachten wird. Es riecht nach Salami, ich kaue eine Leberkässemmel und wir sprechen - wieder - über den Tod von Patentieren. Robert Prosiegel erzählt, dass er eigentlich nie Metzger werden wollte. Er ist es nur aus Tradition. Fünfte Generation und so. »Ich erinnere mich sehr genau, wie ich mein erstes Schwein mit dem Schussapparat geschossen und das Blut rausgelassen habe. Geheuer war mir das nicht und Spaß hat es mir überhaupt keinen gemacht«, sagt der Metzger leise. Robert Prosiegel ist ein besonnener, feinfühliger Mann. Er selber sagt, er sei nicht immer so gewesen. Erst als ihm vor sechs Jahren »das Universum eine Watschn versetzt hat«, er um seinen wirtschaftlichen Erfolg bangen und eine Krankheit überwinden musste, habe er sich auf »Sinnsuche in sich selbst« begeben und seine Faszination für »das Geistige« entdeckt. Seitdem verzichtet er in allen seinen Würsten auf Glutamat, hat einen Kristall auf seinem Schreibtisch stehen und besucht Kabbalah-Sitzungen im Internet.
Die Idee für das Patenschafts-Projekt Sauwohl ist ihm gekommen, als er an einem Winterabend mit seiner Familie die Missstände auf dem deutschen Fleischmarkt diskutiert hat. Preisverfall, Massentierhaltung. Diese Sachen. »Mir war klar: Wenn ein Schwein heute nur noch 160 Euro kostet, wenn Bauern damit 5 bis 10 Euro verdienen, sind sie gezwungenen, mehrere Tausend pro Jahr durchzuschleusen, damit es sich lohnt.« Man müsste also dem Bauern eigentlich einen fairen Preis zusichern, damit der für faire Lebensbedingungen seiner Schweine sorgen kann. So was wie … - 500 Euro. Natürlich fand er bei diesem Versprechen schnell einen Bauern im Nachbardorf, der bereit war, ein Freilandgehege für fünfzehn Sauwohl-Schweinchen zu bauen.
Mein Patenschwein lebt beim Bauer Stache und seiner Frau elf Monate (im Vergleich: Jedes Industrieschweine hat nur fünf), in denen es sich im Dreck suhlen und frisches Gras fressen kann. Dafür bezahle ich pro Monat 10 Euro. Mit mir zusammen sind neun andere Leute Paten dieses Schweines - schon weil ich seine 150 Kilo Schlachtgewicht ohnehin nicht allein konsumieren könnte. So bekommen ich und jeder andere in etwa 13 Kilo Fleisch - als Schnitzel, Kotelett und Gulasch, Schmalz, Presssack, Bratwurst, Hals, Haxe, Bauch und Rücken. Kopf-bis-Schwanz-Verwertung ist wichtig, sagt der Metzger Prosiegel und schiebt schnell nach: »Sie können doch kochen, oder?«
Auf dem Weg aus der Metzgerei zum Schweinehof erzählt Robert Prosiegel wie glücklich ihn wiederum seine glücklichen Schweine machen. Denen beim Rumflitzen und Suhlen zuzuschauen, das sei das pure Glück. »So eine Lebensfreude ohne Einschränkung erlebt man sonst nicht«, sagt er. »Das versetzt einen in einen anderen Geisteszustand.« Und es stimmt: Die Popel sind alle ziemlich schön anzusehen und ich bin überzeugt, dass die Popelwurst eine wird, deren Leben erste Sahne war.
Auch bei meinem Besuch bei Hexenbesen ist der Tod zumindest kurz Thema: »Selbst eine Patenziege wird irgendwann geschlachtet, das kann man illusionslos so zugeben«, sagt Inge Thommes-Burbach, die Chefin vom Vulkanhof in Gillenfeld in der Eifel. Wir stehen im Stall, lauschen dem leisen, friedlichen Malmen und riechen - nichts. Ein moderner, gepflegter Ziegenstall muss nämlich nicht riechen, erklärt mir die Bäuerin, auch nicht wenn da hundertachtzig Ziegen Tag und Nacht drin sind. Dann ziegt nämlich auch der Käse nicht so, der Geschmack ist feiner, zurückhaltender. Es ist mein letzter Patentier-Besuch und wieder lerne ich eine Menge. Genau darum geht es ja, sagt Inge Thommes-Burbach. Mit ihren Patenschaften will sie die Menschen in der Stadt näher an das Leben auf dem Land und mit den Tieren bringen. Sie will ihnen zeigen, was sie und ihre Familie auf dem Vulkanhof machen. Kurz muss ich wieder an Irmgard Strobl in Andechs denken. »Es geht bei der ganzen Diskussion über Transparenz eigentlich immer um Wertschätzung«, hatte die gesagt. »Die Bauern wollen raus aus der Anonymität und Anerkennung für ihre Leistung bekommen.«
Finanzielle Anerkennung, zum einen. Die vierwöchigen Ziegenpatenschaft ist mit ihren knapp 100 Euro die, wenn man Laufzeiten, Produktmengen und -gegenwerte vergleicht, mit Abstand teuerste meiner Patenschaften. Zum anderen ist die Anerkennung, die Erzeuger wie Inge Thommes-Burbach sich wünschen, aber auch etwas im Kopf der Kunden. Die sollen erkennen, dass der Rotschmierekäse nicht aus dem Kühlregal kommt, sondern dass darin die Arbeit einer ganzen Familie steckt. Deshalb führt die Bäuerin im Jahr mehr als zweitausend Menschen, Paten, Besucher und Schulklassen über ihren Hof, lässt sie ihre Ziegen streicheln, manchmal sogar melken. »Wir haben da ein paar geduldige Tiere rausgesucht, denen macht das nichts«, sagt sie lachend. »Natürlich lassen wir uns damit tief in die Karten schauen, aber wenn man so arbeitet, dass man es sehen lassen kann, ist das ja in Ordnung.«
Am Ende meiner Patenschaftstour bin ich überzeugt, von diesen Tieren tatsächlich ausschließlich gute Lebensmittel zu kommen. Käse, Eier und Joghurt habe ich schon probiert - tadellos. Und auf das Schweinepaket freue ich mich, weil ich weiß, dass darin ein sauglückliches Landschwein namens Popel steckt. Mein Schwein. Das sich bis dahin noch ausgiebig suhlen und im Schweinsgalopp herumrasen wird.
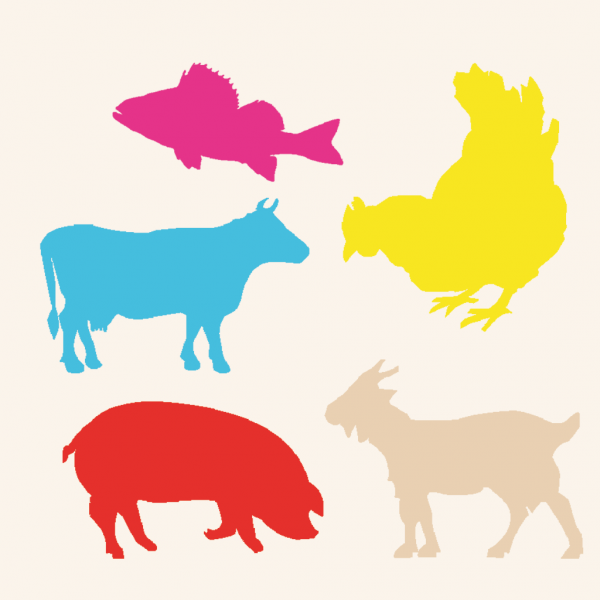


Großartige Idee,
leider war ich als gehetzter Großstadtmensch mit Ihrem
ungegliederten Text überfordert.
Da muß ich mir echt extra zeit nehmen ihn zu lesen.
Gliederung wäre hilfreich.
mfG Johann Wagner, Berlin
zaunfried@gmx.de
Sorry, da haben Sie natürlich recht. Wir sind dabei, die älteren Beiträge zu aktualisieren, sind aber bei Effilee 26 eigentlich längst nicht angekommen. Diesen Beitrag werden wir dann aber vorziehen …