Gestern wurde in Berlin bekannt gegeben, dass die Restaurants wieder öffnen dürfen. Wir standen um die ganzen aufgetürmten Thermoboxen, haben uns angeschaut und uns grinsend gefragt, ob wir noch wissen, wie das geht. Zu viert an einem Teller basteln. Am Abend für maximal vierzig Personen kochen. Wobei’s jetzt ja erst einmal dreiundzwanzig sein werden. Es geht wieder zurück zu unserem täglich Brot, das Acht-Gänge-Menü für den geneigten Genießer.
Hinter uns liegt eine Aktion, in deren Verlauf sich gezeigt hat: Unterstützerbereitschaft ist genauso ansteckend wie das Virus, das sie auf den Plan gerufen hat. Aber davor muss ich erzählen, wie alles angefangen hat.
Ziemlich hemdsärmelig nämlich. Man stelle sich einen mäßig frustrationstoleranten Koch vor, der aber vernunftbegabt ist. Deshalb gelang es Max Strohe Mitte März nicht länger, die Virologenwarnungen und Infektionsstatistiken zu ignorieren. Außerdem hat er seine Mitarbeiter und seine mittlerweile immer zaghafter eintrudelnden Gäste sehr gern - auch wenn seine grimmige Miene und seine Wortkargheit manchmal etwas anderes suggerieren. Da diesbezüglich Konsens mit seiner weit weniger wortkargen Partnerin herrschte, packte er seinen Leuten fette Proviantkisten und machte die Schotten dicht, quasi von heute auf morgen.

Nun verschanzten die beiden sich in ihrer nervtötend winzigen Wohnung und füllten Kurzarbeitsanträge und Kreditformulare aus, die ihnen Liquiditätsprognosen für die nächsten zwölf Monate abverlangten. Und das in einer Zeit, in der selbst die Experten ihre Einschätzung der Pandemieentwicklung alle zwei Tage korrigierten. Das alles war dröge, beschwerlich und fühlte sich insgesamt an, als müsse man sich mit einem Espressolöffel das eigene Grab schaufeln, an einem Tag mit Bodenfrost und Nieselregen.
Und dann gab’s ein kleines Grundsatzgespräch über die überhaupt nicht ungewisse Zukunft des Kühlhausinhalts, denn all jene Dinge, die nicht mehr in die Proviantboxen gepasst hatten, blickten einem düsteren Ende am Grunde der Biomülltonne entgegen. So was schlägt einem Koch, der liebt, was er tut, eine tiefe Wunde. Das Pflaster hieß Kochen für Helden.
Am 17. März machten wir uns also auf ins Tulus Lotrek, der Strohe schnappte sich seinen voluminösesten Topf und verarbeitete dreißig Kilo astreines, trocken gereiftes Färsenentrecôte zu hundert Litern Gulasch. Während der Topf brodelte, telefonierte ich die umliegenden Arztpraxen ab - allerdings erst, nachdem bei der Feuerwehr niemand abgehoben und die Polizei mir glaubhaft versichert hatte, dass eine gleichwie geartete Gulaschübergabe den Tatbestand der Beamtenbestechung erfüllen würde. In den Gemeinschaftspraxen reagierte man dagegen hocherfreut. Man erklärte mir, da das Wartezimmer von selbstdiagnostizierten Coronapatienten nachgerade überlaufen werde, die Mittagspause demzufolge kurz gerate und Nahrungsbeschaffung dieser Tage ohnehin schwieriger sei, da die Imbisse sukzessive schlössen, käme gerade nichts gelegener als das Färsengulasch.

So begann sich ein Bedarf anzudeuten, der in den nächsten Wochen immer größer wurde. Uns erreichten Schilderungen von Doppelschicht schiebenden Ärzten, die sich tagelang am Snackautomaten ernährten, weil die Krankenhauskantine geschlossen worden war. Wie soll das Personal kontaktlos an den Kuchen kommen? Wenn Eskalations- und Worst-Case-Szenarien ausgearbeitet werden müssen, in denen das Wort Triage eine Doppelseite ausmacht, hat eine Klinikleitung andere Prioritäten. Das ist einwandfrei nachvollziehbar.
Max hatte den folgerichtigen Gedanken, dass seine unverkäufliche Kühlhausfülle eine Entsprechung in den Kühlhäusern der Zulieferer haben müsse. Er startete einen kleinen Instagramaufruf, in dem er »Ich koche für Menschen in systemrelevanten Berufsgruppen« salopp mit »Ich koche grade für Helden« abkürzte, und hängte sich ans Telefon, klapperte seine Lieferantenkontakte ab, und schon der erste - Rungis Express - brachte ohne zu zögern so viel Ware auf den Weg, dass wir nicht wussten, wohin damit. Fast gleichzeitig befand Tim Mälzer, dass Kochen für Helden eine gute Idee sei, und trommelte halb Hamburg zusammen. Zack - war’s ’ne Bewegung.
Es ging alles ganz schnell. Unsere Freunde aus dem Café 21gramm kamen zu Hilfe, organisierten eine tägliche Liefertour, verstärkten uns in der Küche und waren bald unverzichtbar auch in der Organisation und im Büro, denn wir konnten uns vor Anfragen nicht retten. Helden, Gastronomen, Warensponsoren, Freiwillige, hie und da auch zwielichtige Gestalten kamen auf uns zu. Die Presse rannte uns die Bude ein, und wir hielten unsere übernächtigten, verschwitzten Gesichter in jede Kamera, die sich uns entgegenstreckte, denn wir konnten Hilfe gebrauchen.

Dafür mussten wir gewährleisten, dass die Aktion richtig - also in unserem Sinne verstanden wurde. Wir wollten, dass all jene, die sich engagieren, personalarm kochen, kontaktarm liefern, unter Einhaltung höchster hygienischer Standards produzieren und sich ohne Gewinnabsicht miteinbringen. Das alles zu definieren, irgendwo festzuschreiben und zu verbreiten, tat Not. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft wir am Telefon erklären mussten: »Nein, du kannst jetzt unter unserer Flagge nicht acht Köche aus der Kurzarbeit holen und dich mit deinem Foodtruck auf den Marktplatz stellen, um Burger zum halben Preis herauszuhauen.« Oder: »Nein, es ist nicht sinnvoll, fünfundzwanzig Freiwillige von der Couch zu holen, um mit Lastenrädern jeweils zwei Portionen Suppe durch die Stadt zu karren.«
In der zweiten Woche gründeten wir eine Firma (eine Vereinsgründung hätte acht bis zwölf Wochen gedauert und wir mussten sofort handlungsfähig sein) und ließen die Marke Kochen für Helden eintragen, weil eine findige Eventagentur uns zu unserem kleinen Projekt gratuliert und sich selbstlos dazu bereit erklärt hatte, das für uns zu übernehmen. Im nächsten Schritt gab sie aber ziemlich unverhohlen zu verstehen, dass man da nun auch mal darüber nachdenken könnte, ob man das den Krankenhäusern nicht auch gewinnbringend verkaufen könnte, wenn es »einen richtigen Versorgungsengpass gibt«. Da sei zwar Gott vor, aber immerhin: Der Brand sei sehr populär und das sollten wir nicht verspielen.
Eine Armada an bereitwilligen Helfern sprang uns zur Seite, um uns und unsere Idee zu verteidigen. Unser Steuerberater stand uns pro bono zur Seite. Ein famoser Markenrechtsanwalt zog eine unübersehbare rote Linie, die daraufhin auch keiner mehr zu übertreten wagte. Unsere Haus- und Hofgrafiker entwarfen ein Logo - den kleinen Kochtopf im Cape - und bauten über Nacht eine Homepage, um fortan die Aktion, ihre Leitlinien, die Durchführung und die teilnehmenden Restaurants nach außen zu kommunizieren. So hatten all jene, die ein warmes Mittagessen gut gebrauchen konnten, im Idealfall auch gleich einen direkten Ansprechpartner in ihrer Nähe.
Mittlerweile sind einhundertzwei Restaurants auf unserer Deutschlandkarte verzeichnet und erste Hochrechnungen ergeben eine stattliche Summe. Rund fünfhunderttausend Mahlzeiten, sind über die verwaisten Theken der Gastronomen gewandert.
Wie sie das Kochen für Helden anstellten, blieb dabei allen selbst überlassen. Das trieb höchst unterschiedliche Blüten. In München beispielsweise fanden sich ein paar großkalibrige Köche in der Riesenküche des Hofbräukellers zusammen. In Hamburg waren’s gleich neun Restaurants um Tim Mälzer und Fabio Haebel, die sich beteiligten. Aber auch in ländlichen Gefilden fanden sich eifrige Einzelkämpfer, wie etwa das Landhaus Köhle, das sich aufmachte, das Bodenseer Hinterland zu versorgen. Wir hier in Berlin taten uns auch zusammen, das Brlo-Brwhouse um Ben Pommer und Katharina Kurz stellte ein Zentralwarenlager auf die Beine und schickte jeden Tag eine Bestandsliste an die Gastronomen, die sich dann daraus bedienen konnten.
Und nun ein Wort zum Geist des Gebens, der in den letzten Monaten, die ja für die meisten Branchen äußerst karg ausfielen, so herrlich grassierte: Wir bekamen Lieferwagen von Mercedes-Benz, ein professioneller Lieferdienst klinkte sich ein, so wie unsere langjährigen Partner Rungis, Havelland, die Metro, Weiss Fruchtimport, Lehmann und Preussenquelle. Sie stellten uns unkompliziert Ware zur Verfügung, die Gasag verteilte Energiegutscheine an die Berliner Gastronomen, die sich engagierten. Und die Plakatwerber von Ströer schenkte uns für zehn Tage deutschlandweit Werbeflächen, auf denen wir uns bei all den Helden der Krise und den Unterstützern bedanken konnten.
Wenn man Max fragt, worin die eigentliche Herausforderung des Kochens unter Coronabedingungen bestand, sagt er: »Fehlende Planungssicherheit.« Man kann nicht im Voraus entscheiden, was man kochen wird, wenn man mit geschenkten Zutaten arbeitet. Oft bekommt man verständlicher- und richtigerweise Ware, die ihrem MHD entgegenfiebert. Man muss sie folglich schnell verarbeiten, und nicht selten steht der Koch morgens um sieben vor einer Palette vollreifer Melonen, zwei Säcken Kichererbsen und zwei Stiegen Magerquark und fragt sich, was zum Geier er jetzt daraus Wohlschmeckendes kredenzen soll. In diesem konkreten Fall war die konkrete Antwort übrigens: nichts. In jedem Fall aber telefoniert man zwei, drei Dezibel lauter, als der spendable Großlieferant am anderen Ende es bräuchte, um die Vorratslücken zu schließen, die zwischen einem panischen Koch im Jetzt und einem glücklichen Pfleger in der Zukunft klaffen.
Spontanität war also das Gebot der Stunde, und die gehört wahrlich nicht zum Arbeitsalltag eines Sternekochs, nicht einmal wenn er so ein Rezeptverweigerer und Impulskoch ist wie der Strohe. Wenn hier normalerweise etwas die Küche verlässt, wurde mindestens tagelang daran gefeilt. Man kennt die Produkte, die Qualität, den perfekten Garpunkt und die exakten Mengen der einzelnen Komponenten. Kochen für Helden funktioniert ganz anders. Man macht das Beste aus dem, was täglich geliefert wird. Das kann hie und da ganz spannend sein, vor allem, solange der Reiz des Neuen noch alles würzt. Unsere Köche sind ja nicht zufällig am zwangsneurotischen und kontrollsüchtigen Ende des gastronomischen Spektrums gelandet.

Wenn wir gerade bei den herausfordernden Aspekten sind, gehört auch noch Folgendes erzählt: In Berlin haben wir Kochen für Helden schnell verstetigt. Wir wollten dauerhaft und verlässlich jene entlasten, die sich gerade für uns bucklig schuften - bei nicht geringen Risiken für ihre eigene Gesundheit, wohlgemerkt. Wir haben also für dieselben Anlaufstellen jeden Tag - auch am Wochenende - gekocht. Zu Beginn prasselte die Begeisterung auf uns ein. Wir erhielten Fotos von Menschen in Ganzkörperkondomen, die sich - der Mundschutz baumelte noch am Ohr - endlich eine kleine Pause und damit ein Schälchen Eintopf gönnten. Die ganzen kleinen Dankeschöns, die Zeichen und Zeilen der Freude wurden in die Küche weitergeleitet und dort wurde sofort zurückgestrahlt. Nach einem langen Tag am Schneidebrett, wenn der Kampf mit fünfzehn Säcken Roter Bete schließlich gewonnen ist und man sich ein bisschen fühlt, als käme man aus der Kantine im Altenheim, schaut man sich so ein Foto an, und das ist dann wie ein Daseinsberechtigungsschein. Man fühlt sich auch ein klitzekleines bisschen systemrelevant.
Wenn nun aber beide Seiten sich an den Deal gewöhnen, gibt’s irgendwann keine Fotos mehr. So ist der Mensch. Dann kommt der Fahrer in der sechsten Woche in die Küche und sagt: »Wenn’s noch mal was mit Tofu gibt, will die Station XY das Restaurant wechseln.« Oder: »Der Pförtner hat gesagt, gestern waren die Kartoffeln zu groß geschnitten.« Dann weiß man zwar, dass das die flapsig vorgetragene Einzelmeinung eines überarbeiteten Klinikmitarbeiters ist, man will es verdammt nicht überbewerten, aber auf die Motivation geht es trotzdem. Denn wenn man’s ehrenamtlich macht, dann ist die Währung, in der man abrechnet, ja das Danke, dass du für mich da warst des Rezipienten. Es fühlt sich zäh an, wenn das fehlt. Und man beginnt, die Frickelteller zu vermissen, in deren Komplexität man sich retten kann, wenn das direkte Feedback mal keine Standing Ovation ist. Wenn man die kleine narzisstische Kränkung indes verwunden hat, fragt man sich ganz schnell, ob die Menschen in den Funktionsberufen eigentlich gerade oft genug ein Dankeschön zu hören bekommen.
Heute haben wir angefangen rückzubauen. Der zweite Gastraum sah aus wie das Wohnzimmer eines behandlungsresistenten Messis. Dort lagert ein stattliches Arsenal an wiederverwendbaren Zehn-Liter-Eimern und Mega-Mixstäben. Über deren künftige Verwendung wird kontrovers diskutiert. Genauso wie über den weiteren Verlauf des Projekts. Denn auch wenn das Restaurantgeschäft nun wieder beginnt, wir wollen Kochen für Helden nicht versanden lassen.
Ein Kommentar


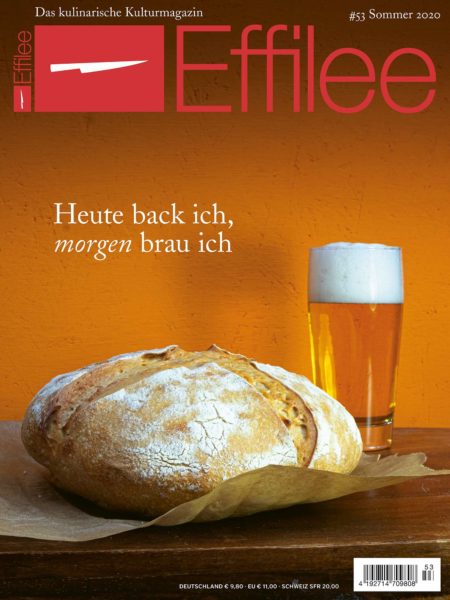
Großartig. LIEBE-voll. So sind sie, Ilona Scholl und Max Strohe. Eine wunderschöne Geschichte wunderbar geschrieben! Danke.